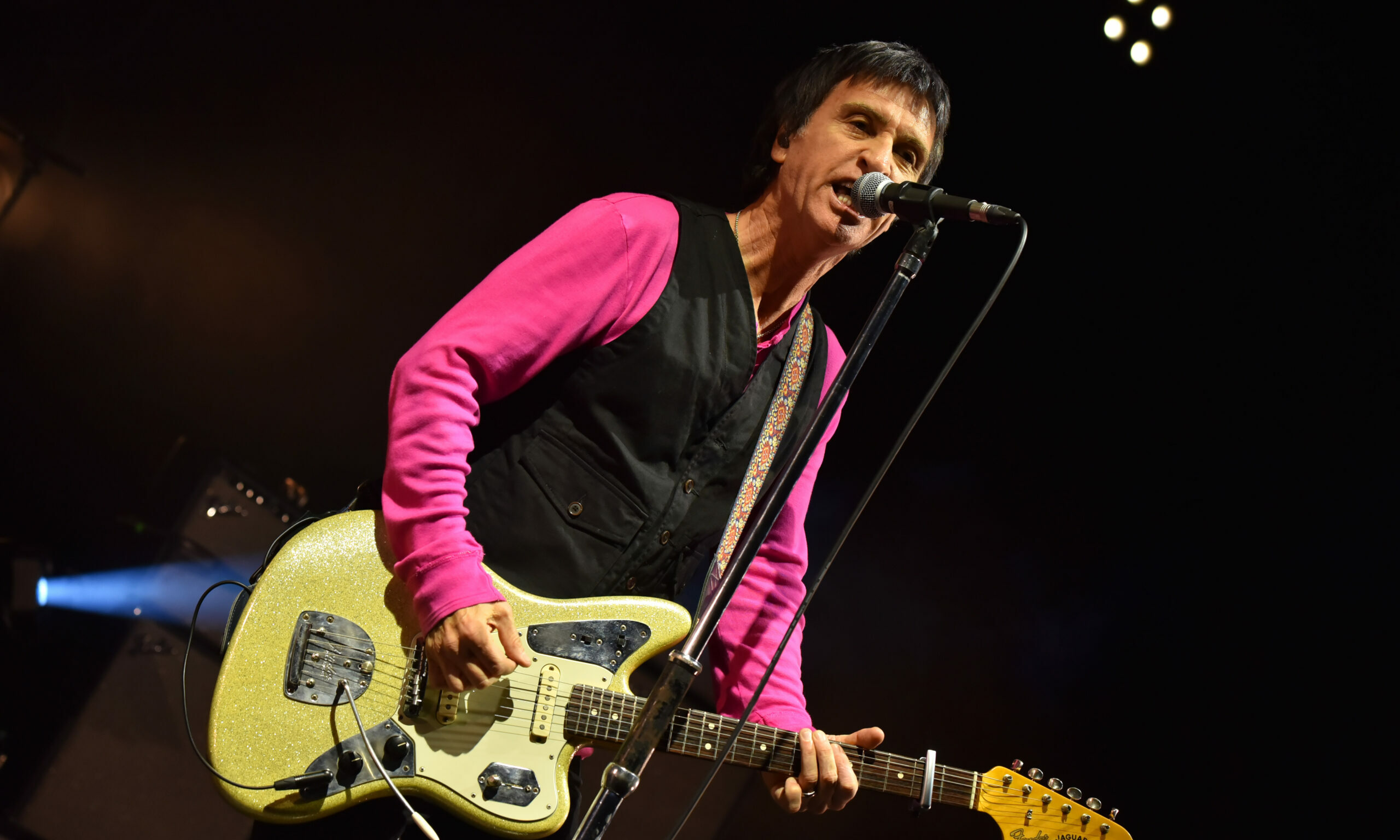VIER FREUNDE SOLLT IHR SEIN

Alex Kapranos sitzt in einem jener klobigen Kunststoffsessel, die Hotels aufgrund ihrer Abwaschbarkeit gerne in ihren Außenbereichen platzieren. Er trägt dunkel und sieht ein wenig aus wie der junge Bryan Ferry. Neben ihm hat sich Nick McCarthy niedergelassen, er hat ein sehr buntes Hemd am Leibe und erzählt von der Nacht, die er nicht im Hotel, sondern bei Freunden im Berliner Vorort Kleinmachnow verbracht habe. Die beiden reden angeregt über die Musik, die bei Beerdigungen läuft. Genauer gesagt: über Popmusik, die bei Beerdigungen läuft. Gemeinsam gehen wir die Liste der Top-Ten-Todeshits Englands durch. Nummer eins: „My Way“ von Frank Sinatra. Nummer zwei: „Time To Say Goodbye“ von Sarah Brightman und Andrea Bocelli. Nummer drei: „Wind Beneath My Wings“ von Bette Midler. „Ganz schön fies“, sagt Kapranos. „Ich war auf solchen Beerdigungen. Es mag ja sein, dass die Toten Fans dieser Künstler waren! Aber für den Trauernden ist das die Höchststrafe – wie wenn dein WG-Mitbewohner die Musik zu laut laufen lässt, aber die Tür zugesperrt hat. Man kann nichts dagegen tun. Wieso soll man denn als Gast einer Beerdigung leiden?“

Es scheint die Sonne, es weht ein leichter Westwind, die Bedienung hat Espresso, Orangensaft und Pfefferminztee gebracht, nicht nur der nahe München aufgewachsene Mc-Carthy, sondern auch Alex Kapranos bestellt auf Deutsch. Alle sind also bester Laune, wie da über Beerdigungen gesprochen wird. Wobei eigentlich natürlich ein Song der neuen und vierten Franz-Ferdinand-Platte RIGHT THOUGHTS, RIGHT WORDS, RIGHT ACTION das Thema ist, genauer: „Goodbye, Lovers And Friends“, der Schlusstrack des ersten Albums seit 2009.
Kapranos spricht gerne über seine Texte. Die Musik dagegen, die preist er auf eine eigenartige Weise an. Sehr freundlich, aber man weiß nicht, ob das jetzt ironisch gemeint ist oder nicht. Er erklärt die Musik der neuen Platte genau, vielleicht wie ein Obsthändler seine Auslage. Nicht wie einer dieser Plärrer auf dem Markt am Maybachufer, sondern wie ein Ladenbesitzer im Wimmelbuch das machen würde. Hier die Äpfel, schauen Sie nur, die roten Backen! Da die Birnen, hier die Ananas. Und da in der Ecke haben wir sogar Kapstachelbeeren, und die dicke Dame da hinten an der Registerkasse, das ist meine Ehefrau. Im Falle von Franz Ferdinand geht es eben um Cumbia-Rhythmen, türkischen Pop, eine Verbesserung der eigenen Produktions-Skills – Alex Kapranos half der jungen Band Citizens! im Studio -, Saxofone und um House-Beats. Und statt von dicken Frauen erzählt er von Todd Terje, Alexis und Joe von Hot Chip oder Björn Yttling, die jeweils bei zwei Songs ein bisschen mitproduzierten. Mit technischen Details, so sagt Kapranos, möchte er einen wirklich nicht aufhalten. Nichts sei doch langweiliger als Bands, die aus dem Studio berichten. Nur zur Zusammenarbeit mit Yttling hat er eine kleine Anmerkung parat: Dessen Stockholmer Domizil sei so hochqualitativ geschmackssicher und gleichzeitig funktional gestaltet, man fühle sich wie in einer Filiale der Kaufh auskette Manufactum.
Das mit den Details, die laut Kapranos so langweilig seien, dass man den Journalisten damit nicht belasten wolle, ist eine interessante Sache. Denn zuletzt, beim vor vier Jahren erschienenen TONIGHT: FRANZ FERDINAND, wurde viel und gerne über die musikalische Horizonterweiterung gesprochen, über die knapp acht Minuten von „Lucid Dreams“ und den Produzenten Dan Carey, der die Band mit sowjetischen Keyboards ausstattete und sogar dazu ermunterte, ein menschliches Skelett perkussiv zu beklöppeln. Der Subtext war damals: Wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind nicht mehr eine dieser Bummzack-Bands, die 2004/2005 als vielleicht letzte Generation überhaupt die Fahne des guten, wahren Gitarren-Indies hochhielt und von denen die meisten mediokre Popsongs plärrend in der Bedeutungslosigkeit untergegangen sind. Wir sind nicht die Kaiser Chiefs oder so. Wir haben mehr drauf. Wir sind gegenwärtig.
Vielleicht war das zu viel. Sowohl das mit dem eigens gebuchten Super-Produzenten und dessen Soundverschiebungen als auch das viele Gewese darum. Vielleicht hat man als Band aber auch ab einem gewissen Zeitpunkt keine Lust, die Sache mit den Einflüssen groß zu erklären. Vielleicht möchte man sich auch nicht ständig beweisen müssen, in einer Welt, in der jedes künstlerische Material stante pede auf seine Relevanz abgeklopft wird.
Diesmal setzte man sich also ein paar knappe Leitfäden. Leitfäden, da kennen Franz Ferdinand sich aus. Man wolle, so hieß es vor vielen Jahren einmal, Platten aufnehmen, zu denen Mädchen gerne tanzen, seitdem steht der Satz in jedem zweiten Bandporträt. Deshalb dürfte Kapranos sich der Wirkung der Sätze, die er nun dem Journalisten ins Diktiergerät spricht, durchaus bewusst sein. „Die Essenz von Franz Ferdinand sind vier Leute, die in einem Raum Musik machen – gemeinsam“, ist der erste. Der zweite: „Die Songs waren diesmal wichtiger als die Sounds.“ Der dritte wiederum wiederholt die Botschaft von anno dazumal: „Es ist eine Tanz-Platte.“ Diese Regeln erarbeitete man ohne kommunikatives Hintergrundrauschen: Weder die Plattenfirma noch die Presse waren als Zaungäste zugelassen. Auch das war früher anders. „Wir hatten während des gesamten Aufnahmeprozesses ein virtuelles ‚Do not disturb‘-Schild an unserer Tür hängen“, erzählt Alex Kapranos. „Es ist nämlich ganz einfach: Wenn Außenstehende kommen, sprichst du mit denen. Und dann fängst du an, untereinander zu diskutieren. Das verunsichert dich, und wer verunsichert ist, macht keine guten Platten.“
Verunsicherung. Druck. Kann man nicht gebrauchen als Band, erst recht nicht, wenn draußen Millionen von Gescheithubern geiernd kreisen. Mögliche Fragestellungen: Sind Franz Ferdinand überhaupt noch zeitgemäß? Passt deren Gitarrenpop – und das hier ist Gitarrenpop, da ändern auch Todd Terje und Hot Chip nichts dran – noch in eine Gegenwart, die Trends nur monatsweise zulässt? Alex Kapranos, der neckisch einwirft, man sei ja wohl genauso innovativ am Werkeln im Graubereich zwischen Pop und Dance wie die eben genannten, scheint sich dieser Problemstellung durchaus bewusst zu sein und widmete dem Thema „Relevanz“ gleich vier Twitter-Einträge. Bissiger Grundtenor: Was für eine blöde, blöde Welt, die Musik so einordnen möchte, wo es doch meistens ganz einfach ist: Band geht ins Studio. Band nimmt gute Platte auf. Band hat nämlich Lust darauf. Und dass die Band eben eine ist, deren Bedeutung landauf, landab diskutiert wird -nun, das liegt wohl außerhalb des Franz Ferdinand’schen Zuständigkeitsbereichs.
Überhaupt, so sagt Kapranos, sei das mit der Gegenwart und der Art, wie Musiker diese be- und vertonen würden, so eine Sache: „In den vergangenen Jahren wuchs die Distanz zwischen Bands, die sich als melodiöse Popbands, Bands, die sich als Gitarrenrockbands und Bands, die sich als Dance-Bands sehen. Gerade deshalb klingt es bei manchen so krampfig, wenn sie da Brücken schlagen wollen. Da verwenden dann plötzlich alle Sequencer und irgendwelche Elektro-Patterns. Ich bin wirklich scheißgelangweilt von all diesen Idioten, bei denen irgendwelche blöden Computerbeats laufen.“ Das sei sinnlos: „Die sollen live spielen. Schaut euch verdammt noch mal die Bands der 70er-Jahre an. Die J.B.’s! Besseren Groove wirst du niemals hören. Der Mensch hat ein ganz gutes Rhythmusgefühl.“
Tatsächlich nimmt man es Franz Ferdinand ab, wenn sie erzählen, dass ihr Schaffen von dem, was draußen geredet wird, wenig beeinflusst wird. Auch erwähnte Produzenten seien Stichwortgeber gewesen, die aber niemals den Sound von der Band entfremdeten. „Ein Produzent kann dir natürlich helfen. Björn hat uns etwa beigebracht, dass lautere Drums besser klingen, wenn man sie leise einspielt und im Nachhinein hochzieht. Von Hot Chip liehen wir uns den Engineer, und sie singen auf ,Goodbye, Lovers And Friends‘. Aber die Rolle von Produzenten wird überbetont. Ein Produzent sollte in erster Linie ein angenehmer Konversationspartner sein. Jemand, mit dem du auf einer Wellenlänge liegst und der dich vielleicht auf gute Ideen bringt. Es ist nicht so, dass deine Songs besser werden, wenn Butch Vig mit im Studio herumhängt.“
Aber was macht denn einen guten Franz-Ferdinand-Song aus? Kapranos überlegt. „Nun, das kann eine textliche Idee sein. Eigentlich muss es sogar eine Idee sein. Ich glaube nicht, dass es Lieder von uns gibt, in denen nicht von irgendeiner seltsamen Begebenheit berichtet wird.“ Das glaubt man gerne bei einer Band, deren eigene Klangforschungslabore Namen wie „Sausage Studios“ und „Black Pudding Studios“(auf Deutsch: Wurst- bzw. Blutwurst-Studios) tragen. Und so kramt Kapranos im Erfahrungsschatz, der in diesem Album mündete. Da ist eingangs erwähnte Begräbnismusik. Aber eigentlich steckt hinter jedem der Songs so ein Ansatzpunkt. „Love Illumination“ etwa ist ein Lied, das auf Blackpool Bezug nimmt -jenen Ort, der als erster auf der Welt komplett elektrifiziert war und der als Geburtsstätte des modernen Massentourismus gilt. „Einmal im Jahr werden dort ganz viele Lichter installiert und angeknipst. Im 20. Jahrhundert war das ein Ereignis, zu dem die Menschen aus ganz Großbritannien anreisten. Auch ich war als Kind einige Male dort. Heute fühlt sich die Stadt mit ihren Vergnügungsparks, mit ihren Piers und der Strandpromenade wie ein Relikt aus der Vergangenheit an“, erzählt Nick McCarthy Im Song wollte man der Hoffnung nachgehen, die so ein Ort stets verströme. Der Hoffnung, dass man dort etwas erleben könne, eine Pause vom Alltag. Dem Gedanken, dass man dort so etwas wie Liebe, vielleicht sogar Erlösung erfahren könne. Die Gewöhnlichkeit ausschalten. Drummer Paul, so erzählt Nick, habe dort seine Hochzeitsreise verbracht.
Weiter auf dem Inhaltszettel: Glaube in verschiedenen Ausrichtungen -zu nennen ist hier besonders „Evil Eye“ – der böse Blick, der in Kapranos‘, der griechische Wurzeln hat, Gedanken seit frühester Kindheit verankert ist. „Wenn wir in den Urlaub zur Verwandtschaft fuhren, bekam ich sofort nach der Ankunft einen Anhänger mit einem Auge um den Hals, um mich vor diesem bösen Blick zu schützen.
Das Interessante daran ist, dass das natürlich ein Aberglaube ist, und dieser Aberglaube vor allem von denen angewandt wird, die sehr religiös sind. Das ist vielleicht eines der Grundthemen der Platte: logisches Denken vs. Spiritualität und dem unbedingten Willen, an etwas zu glauben.“
Davor ist Kapranos selbst übrigens keinesfalls gefeit. „Ich saß in einem Café in der Ecke der Sausage Studios. Ich schrieb ein bisschen was. Nichts Besonderes, nur Notizen. Irgendwann fing ich an, die Augen zu schließen und die Farbe des jeweils nächsten vorbeifahrenden Autos vorherzusagen. Ich sagte mir also: Die nächste Kiste, die um die Ecke biegt, ist rot. Und wenn sie dann wirklich rot war, löste das sehr viel in mir aus. Ich sprach dann mit Freunden darüber und hatte den Eindruck: Jeder, wirklich jeder macht das.“
Bleibt eine Frage: Was ist eigentlich mit den Knochen vom letzten Album passiert? Die, so erinnert sich McCarthy, habe man an die befreundete Band Sons &Daughters weitergegeben. „Die gibt es leider nicht mehr“, bedauert er. Nach einer Pause führt Kapranos hinzu: „Vielleicht liegt ein Fluch auf ihnen. Vielleicht löst sich jede Band auf, die mit dem Skelett arbeitet. Wir sollten dafür Sorge tragen, dass es jemand bei Kasabian ins Studio schmuggelt.“ Jetzt kichert er wie ein Kind. Und spätestens da erkennt man, was diese Band ausmacht. Franz Ferdinand sind beides: vielschichtig und gewitzt, aber immer auch an der Punchline, am simpel rezipierbaren Slogan interessiert. Wahrscheinlich sind sie auch deshalb noch da.
Franz-Ferdinand-EP S. 1 und 4, Albumkritik S. 97



.jpg)