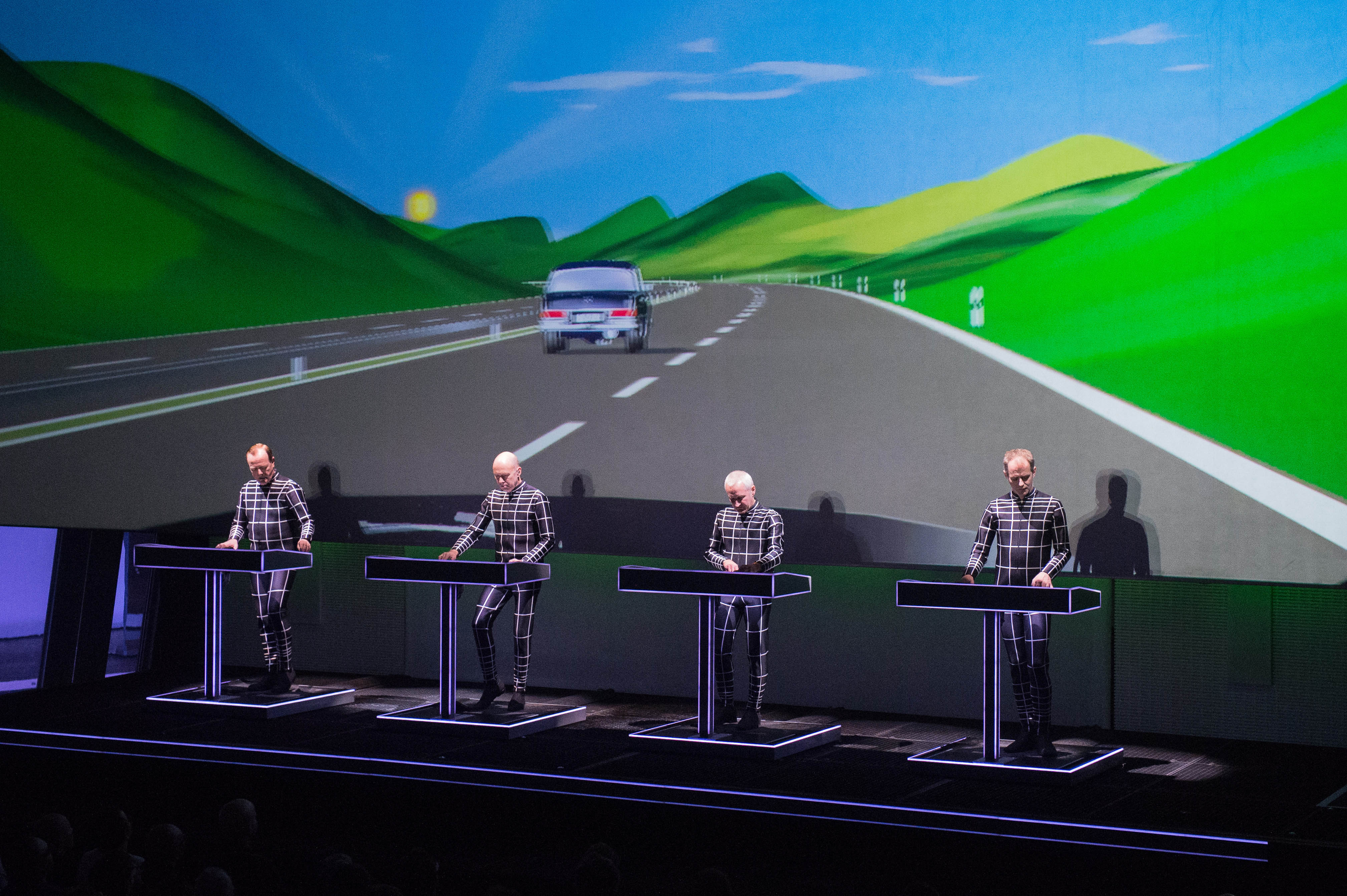Indigo De Souza
ALL OF THIS WILL END
Saddle Creek/Rough Trade (VÖ: 28.4.)
Das Sad Girl packt die Sachen und visiert neue Ufer an: Optimistischer Indie-Rock über die Zweifel an der beschissenen Welt.
Indigo De Souza lässt im Rückspiegel ihr altes Selbst und die Stationen ihrer Jugend vorbeiziehen auf einem Coming-of-Age-Trip mitten hinein in die Selbsterkenntnis: Auf ihrem dritten Album ALL OF THIS WILL END zerlegt die Künstlerin aus North Carolina mit schroff schneidenden Zeilen all die Romanzen, aus denen nie was wurde, die Freundschaften, die stattdessen überdauerten, die Zweifel an dieser beschissenen Welt und am eigenen Platz in ihr. „When I come home / I will begin again“, singt auf dem ersten Stück „Time Back“ – und kehrt nicht nur sinnbildlich in das Haus ihrer Mutter zurück.
AmazonDenn obwohl Indigo De Souza nach ihrem 2021 veröffentlichten, zweiten Album ANY SHAPE YOU TAKE zur Fackelträgerin des neuen Indie-Rock ausgerufen wurde, fiel privat ihre Zuversicht auf den Gefrierpunkt. Sie schmiss ihr Leben um, trennte sich von ihrem Bekanntenkreis und igelte sich in ihrem alten Kinderzimmer ein, wo sie ihren emotionalen Kosmos mit dem Mikrokosmos der US amerikanischen Suburbia vor ihrem Fenster abglich.
Irgendwo zwischen dem Film-Alien aus „Under The Skin“ und Björks „Human Behaviour“
So verwandelt sich der gemähte Rasen der Nachbarn auf „Smog“ zum Inbegrif kleinstädtischer Monotonie, ein Parkplatz zur persönlichen Meditationsoase oder ein Supermarkt zum beependen Kapitalismusmonster. All diesen Schauplätzen begegnet Indigo mit einer Verunsicherung und kindlicher Naivität, als wäre sie eben erst in diese Welt geplumpst – irgendwo zwischen dem Film-Alien aus „Under The Skin“ und Björks „Human Behaviour“.
Und während Indigo auf eben jenem Parkplatz oder ihrem geliebten Kajak unter dem Einfluss von Psychedelics mit dem abwesenden Vater und toxischen Beziehungen abrechnet, entstehen, wie in „You Can Be Mean“, rasiermesserscharfe Einzeiler – „I’d like to think you got a good heart and your dad was just an asshole growing up“ –, auf denen ihre Stimme erst katzbuckelnd ausschlägt, um dann fröhlich aus dem Outro zu pfeifen.
Durch jedes Gitarrenbrett bohrt sich ein der Schwarzmalerei stur trotzender Optimismus
Denn was bei der emotionalen Entrümpelung glücklicherweise nicht dran glauben musste, ist ihr lieb gewonnener Psych-Indie-Sound, der in seiner Sad-Girl-Nostalgie streckenweise an Snail Mail erinnert, mit dem Berufsweltschmerz einer Lana Del Rey am Realismus eines Bruce Springsteen zerfließt – oder auf dem Indigo, wie die frühen Girlpool, unbeeindruckt ins Mikro rotzen kann. Durch jedes Gitarrenbrett bohrt sich dennoch ein der Schwarzmalerei stur trotzender Optimismus, der mit dem aufkeimenden Frühling in Technicolor um die Wette strahlt.
Die eher skizzenhaften Songs der ersten Hälfte, die manchmal wie mitten im Gedankengang abrupt aufhören, gewinnen auf der zweiten Hälfte des Albums an Länge und an Selbstbewusstsein, spiegeln so auch inhaltlich das schmerzliche Hautabstreifen namens Erwachsenwerden wider. Im Stück „Always“ scheint Indigo mit einem kathartischen Aufbrüllen ihren Körper im wahrsten Wortsinn zerreißen zu wollen, dem sie dann auf „Not My Body“ durch eine strahlende Kopfstimme entsteigt, um mit der sich in Höhen zwirbelnden Pedal Steel zu verschmelzen. Das Urteil ihres Trips? „I don’t feel at home in this town.“ Doch ehe sie die Sachen packt und neue Ufer anvisiert, hinterlässt Indigo eine phänomenale Ode an die Liebe – diese mystische Kraft, die am Ende auch die besten Anfänge schafft.
Autorin: Sonja Matuszczyk