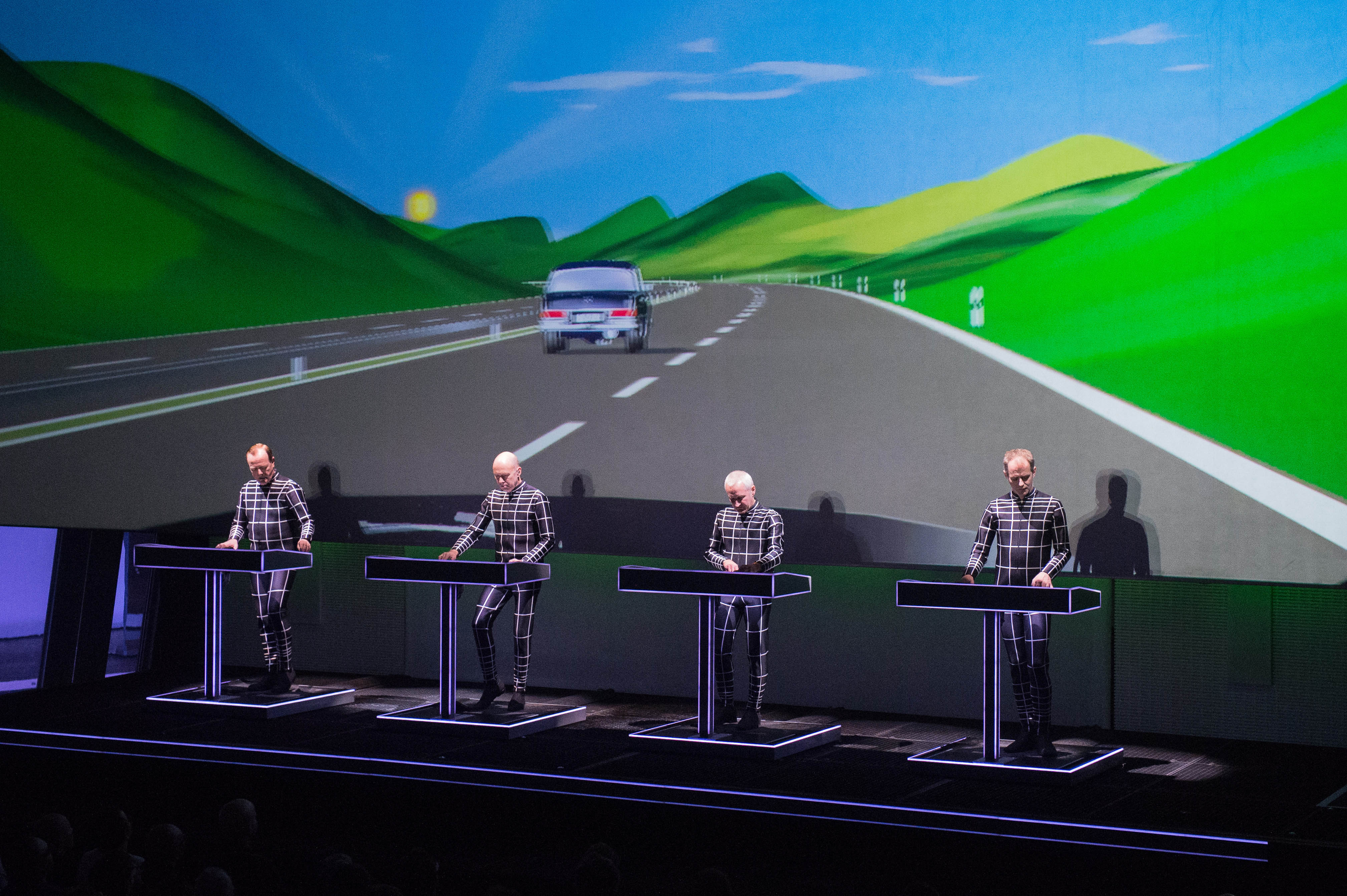Rick McPhail: „“Ich traue mir heute mehr zu“
Rick McPhail trinkt nicht. Keinen Schluck nimmt er von dem Wasser, das der nachmittags chronisch unterbeschäftige Herrscher über die Snackbar zu Beginn des Gesprächs auf den Tisch knallt. Keinen Durst? „Ich wusste gar nicht, dass das meines war“, sagt er nach dem Gespräch und schaut fast ein bisschen traurig.
Rick, erinnerst du dich an deine erste Begegnung mit Tocotronic?
Mein früherer Bassist schenkte mir Mitte der 90er die DIGITAL IST BESSER. Ich dachte damals: Was soll ich damit? Das war Ami-Rock mit deutschen Texten! Ich war damals mehr an Steel Pole Bathtub oder Jello Biafra und all diesen krachigen Amp-Rep-Bands (Amphetamine Reptile, US-Hardcore-Label-Anm. d. Autors) interessiert. Außerdem dachte ich, dass ich nur auf der Durchreise bin, dass ich Deutschland nach zwei, drei Jahren wieder verlassen werde. Ich hatte noch kein so großes Interesse daran, mich mit der Sprache auseinanderzusetzen.
Warum bist du damals nach Deutschland gezogen?
Ich lernte in San Francisco eine Deutsche kennen, und die musste irgendwann zurück, um ihr Studium zu beenden. Und ganz ehrlich: San Francisco war für mich nicht der Hit. Ich wohnte dort in einem üblen Crackviertel -— fast jeden Tag gab es Drive-By-Shootings vor meiner Haustür. Ich wollte einfach nicht die Großstadt und das entsprechende kulturelle Angebot mit meinem Leben bezahlen. Und das Wetter war übrigens nicht so spitze, wie man denkt. Eher ein bisschen wie in Hamburg.
Als ich mit Dirk und Jan über euer neues Album sprach, begründeten sie die Länge einiger Songs mit deiner Vorliebe für US-amerikanischen AOR-Rock. Einverstanden damit?
Ich mag das tatsächlich, diese trockenen Produktionen, bei denen das Schlagzeug fast tot ist. Kansas … oder America. Auch so Prog-Rock-Sachen eine frühe Genesis-Platte, Can und Pink Floyd höre ich echt gerne. Die Bands waren damals nicht gezwungen, alles in dieses kurze Radioformat zu zwängen. „Hotel California“ dauert eben seine acht Minuten. Wo ist das Problem mit einem schönen Gitarrensolo? Aber eigentlich war ich während der Aufnahmen relativ offen. Wenn man wie ich Musik aus mehreren Jahrzehnten hört, hat man oft das Problem, dass man sich bei dem bedienen möchte, was man gerade gerne mag. Deshalb wollte ich gar nicht so sehr selber entscheiden, was wir für einen Sound spielen, und war froh, dass Dirk da schon genauere Vorstellungen hatte.
SCHALL UND WAHN ist das dritte Tocotronic-Album, an dem du mitwirkst. Inwieweit hat sich über die Jahre deine Rolle im Bandgefüge verändert? Anfangs war ich eben noch der Neue. „Der Neue in der Hamburger Schule.“ (lacht) Bei PURE VERNUNFT DARF NIEMALS SIEGEN war ich dementsprechend gehemmt. Das war aber in Ordnung, weil ich das Grundkonzept der Platte ganz gut fand. Der Klang erinnerte mich an Musik, die ich immer gerne mochte, an MURMUR von R.E.M. oder so. Heute traue ich mir mehr zu. Und dann wechselte meine Rolle ohnehin schnell zu der des Gitarristen. Ich spiele auf dem neuen Album nur noch bei „Macht es nicht selbst“ Klavier.
Dabei wurdest du damals in erster Linie als Keyboarder eingestellt. Wie viel hast du selbst mit diesem Rollenwechse) zu tun?
Das begann, als ich noch Tourmusiker war. Ich hörte das „Weiße Album“ (T0C0TR0MC, von 2002), um mir meine Keyboard-Parts rauszufuchsen, und merkte, dass das sehr schwer war. Ich hätte das nie im Leben nachspielen können. Ich frage Dirk, ob man nicht einige Stellen stattdessen auf der Gitarre ausprobieren könne. Dabei merkten wir, dass das für ihn eine ungeheuere Erleichterung war, weil er sich mehr auf den Gesang konzentrieren konnte.
Als einziges Mitglied von Tocotronic bist du kein Muttersprachler. Beeinflusst das dein Verhältnis zu den Texten?
Mir fiel vor allem bei der letzten Platte auf, dass die Leute den Inhalt so wahnsinnig ernst nahmen. In Interviews wurde ewig auf diesem Manifest (eine Art Beipackzettel zu KAPITULATION von 2007 – Anm.d. Red.) herumgeritten, obwohl Dirk das ja auch mit einem Augenzwinkern geschrieben hatte. Das ist aber ein allgemeines deutsches Problem. In den USA oder in England sieht man so etwas anders. Man nimmt die Texte einfach nicht so ernst. Natürlich gibt es gute Lyrics, aber letztlich geht es doch bei Popmusik auch um andere Dinge. Um die Musik, um den Gesang, darum, dass das zusammenpasst. Beck-Texte sind, wenn man von den Songs auf SEA CHANCE absieht, oft totaler Nonsens. Trotzdem höre ich das genauso gerne wie etwa Morrissey.