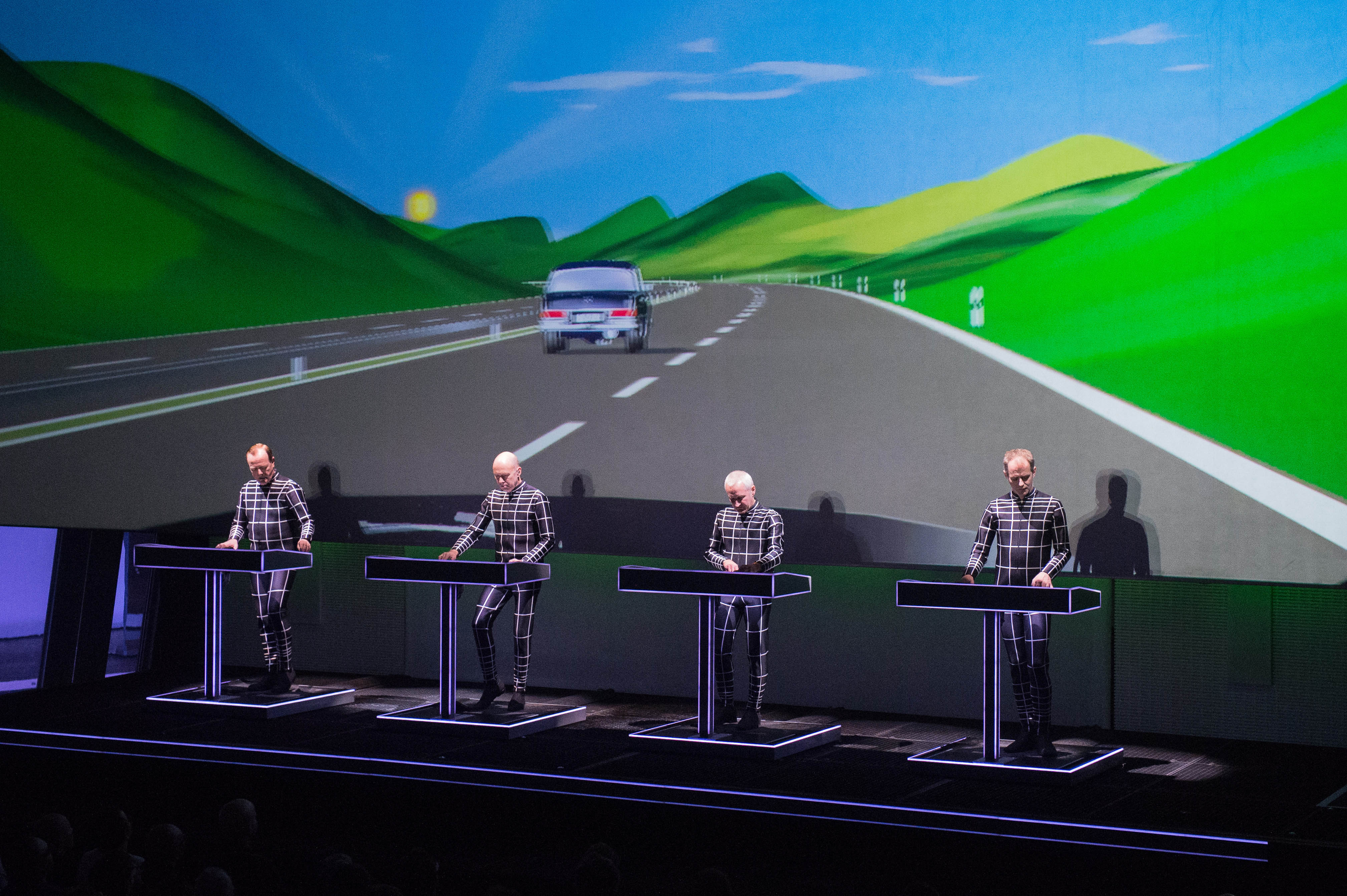„Berlin ist was für Schwanzlutscher! Deswegen hat es mich dort hingezogen.“ – Kay Shanghai
Ja ja, im Ruhrgebiet ist alles grau, die Straßen sind voller Ruß, die Wolken hängen tief, die Menschen gähnen vor lauter Tristesse und nennen ihre Hunde Schalke: denkste.
Eigentlich fing alles im Alternativen Kulturzentrum im beschaulichen – böse Zungen behaupten: langweiligen – Mülheim an der Ruhr an. Dort veranstaltete Kay Shanghai seine ersten Partys, das ist lange her. Er eröffnete schließlich einen Club in Essen, nannte ihn Hotel Shanghai und hatte damals, vor knapp 13 Jahren, mit ziemlicher Sicherheit keinen blassen Schimmer, dass ihn dieser Laden einmal zu einer Ikone des elektronischen Nachtlebens werden lässt. Mr. Oizo, Andy Butler, Amanda Lepore, Major Lazer: Die Liste derer, die Kay bereits in seinem „Hotel“ begrüßen durfte, sie würde ganze Seiten füllen. Sind die illustren Freunde des Hauses mal nicht zugegen, trasht und lollt es sich im Club mit allerlei Partyreihen trotzdem fantastisch durch die Nacht. Manche frönen wilden Orgien auf den Toiletten, das ist nicht allzu ungewöhnlich. Manche vergreifen sich, wenn sie besonders mutig sind, an den Jägermeister-Pinnchen zwischen den Weichteilen eines Nacktkellners, der sich ab und an auf den Lautsprecherboxen aalt, manche wollen einfach nur tanzen, auch das ist in Ordnung. Es mag kitschig klingen, ist aber wahr: Das Shanghai ist legendär – bis heute. Wenn Kay davon spricht, nennt er es liebevoll „seinen Laden“. Sein Laden ist sein Baby, seine eigens erfundene Twilight Zone, ein Ort zum Stranden, Anders- und gleichzeitig Manselbstsein. Ein Ort, den es sonst so im Ruhrgebiet, ja sogar in Berlin nicht noch einmal gibt.
Wir müssen was machen, sonst passiert hier nix!
Logisch, dass die Hauptstädter danach süchteln und lechzen. Lange schon muss sich Kay immer wieder anhören, warum er so etwas wie das Hotel Shanghai nicht einfach dorthin exportiert. Muss doch funktionieren. Und Essen sei ohnehin der falsche Ort dafür. Langweilig, grau, trist. Aber ist es nicht vielleicht genau dieser Gegensatz aus quietschigem Glamour und Bergbau-Klischee, der den Club zu dem hat werden lassen, was er heute ist? „Kann es sein, dass die Menschen den Ort machen? Die Summe derer, die dort arbeiten und den Laden betreiben?“, fragt Kay zurück. Wir sitzen vor seinem neuen Projekt, diesmal tatsächlich in Berlin, ein Projekt, das um Einiges größer als sein kleiner Laden in Essen ist: das Musik & Frieden. Sein zweiter Club. Heute findet dort seine erste Party statt. Weitere sollen folgen, es ist, wenn man so will, sein neuer Nebenjob. Und Kay ein Faszinosum. Hinreißend ist es, ihm dabei zuzusehen, wie er alles für diese eine Nacht delegiert, seinen Mitarbeitern im Minutentakt Antworten auf wichtige Fragen gibt, organisiert und telefoniert, Türen öffnet und Biere. Viele Freunde aus der Heimat sind gekommen, um ihn heute in Berlin zu feiern. Kay wird am nächsten Tag sagen, wie viel ihm die Party bedeutet hat, er wird traurig sein, dass alles so schnell vorbeiging, und er wird sich wieder auf den Weg nach Hause machen.
Zu Hause, das ist Mülheim. „Ich bin letztens mit dem Rad nach Essen über die stillgelegte Bahntrasse gefahren, da hab’ ich zwischen all dem Grün und Grau wieder gemerkt: Ich bin ’n Pottjunge“, sagt er, als wir mit seinen Jungs im Backstagebereich zusammensitzen und unser Bewusstsein erweitern. Darüber, dass Berlin doch eigentlich am schönsten ist, wenn man auf Menschen aus dem Ruhrgebiet trifft. Festgestellt, just in diesem Moment, als der eine „Hasse dat schon gehört?“ und jemand anders „Wat?“ sagt. Draußen rasselt die U1 geradewegs auf die Fensterfront, hinter der unsere Gesichter kleben, zu und biegt in letzter Sekunde über die Oberbaumbrücke nach Friedrichshain ab.

Die Sprache verbindet die Herzen, das weiß auch Jan Kempinski, der 2013 mit einer Handvoll Freunden den Blog „Hömma“ gegründet hat. Der Name lässt erahnen, worum es bei diesem Projekt geht: empfehlen und dokumentieren, was im Ruhrgebiet geht. Konsequent, das Ganze direkt auf den Pott-typischen Ausruf Hömma (Hochdeutsch: hör mal) zu taufen. Wenn man dem Folge leistet und Jan zuhört, merkt man schnell, dass er für seine Heimat kämpft. „Wenn ich im Pott wohne und mir manche Sachen nicht so gefallen, ist nicht der logische Schluss, nach Berlin zu ziehen, sondern das, was mich stört, zu verbessern.“
Jan ist nicht nur Blogger, sondern auch Chefredakteur von „Heimatdesign“, einem Magazin für Design aus der Region. Er lebt in Dortmund und liebt die Gegend für die vielen Möglichkeiten und den Platz, Ideen zu realisieren. Ganz so einfach sei das aber nicht immer, weil Clubs oft nicht als Kulturstätten anerkannt werden. Das bekommt er bei seinem Freund mit, dem das Tanzcafé Oma Doris gehört und der immer wieder mit der Stadt über den Fortbestand verhandeln muss. Im Ruhrgebiet arbeitet man nun mal besonders hart, das war schon immer so, und scheint auch so zu bleiben. „Kreative müssen Durchhaltevermögen beweisen“, sagt Jan und spielt mit diesem Satz nicht nur auf die Interaktion mit der Stadt, sondern auch mit dem Publikum an. Letzteres sei nämlich gar nicht so leicht zu beeindrucken, dafür aber voll bei der Sache, wenn man einmal geschafft hat, es zu knacken.