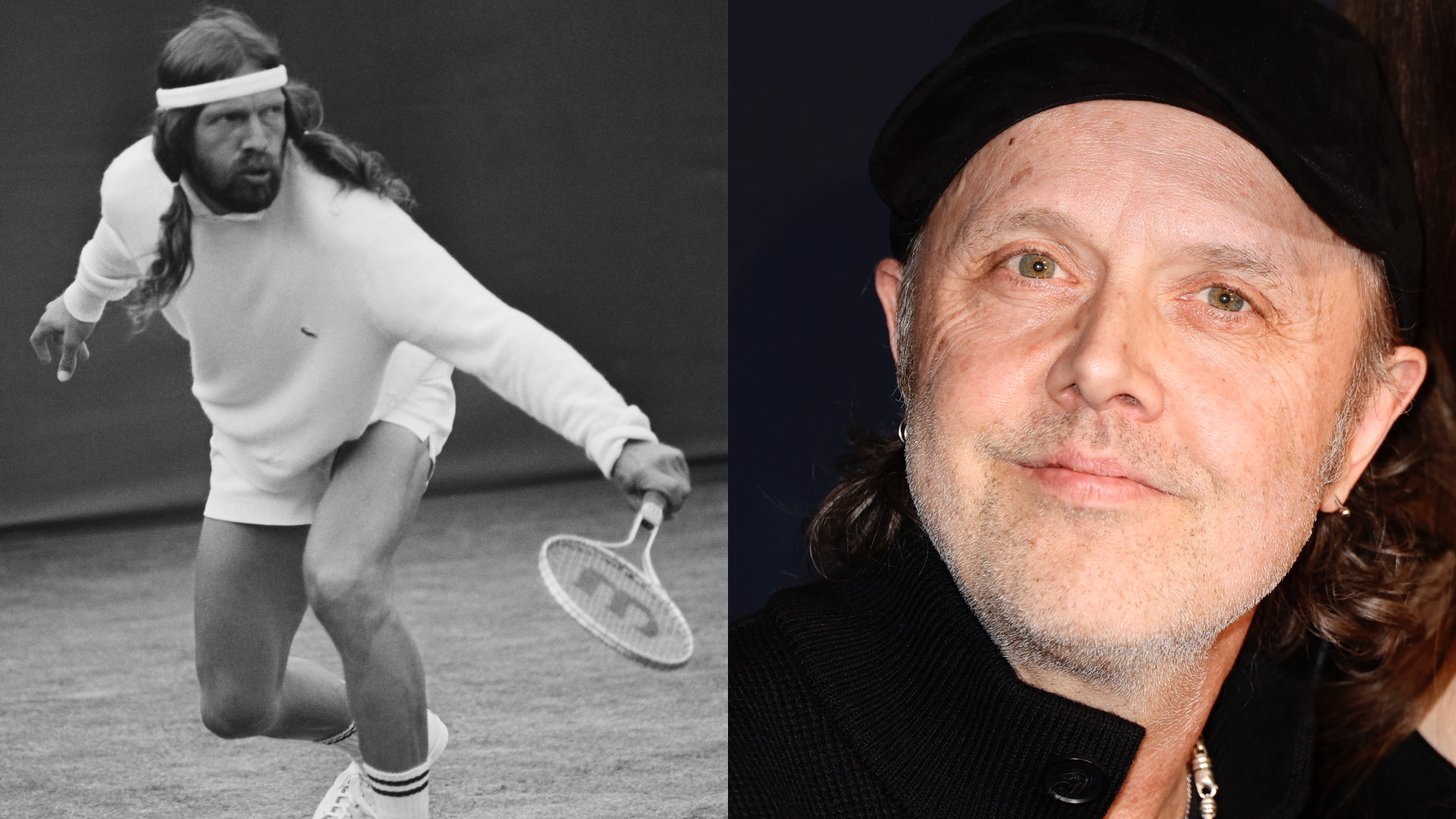An der Front
Peinlichkeit als Grenzerfahrung: Christoph Schlingensief und die Relevanz des Absurden.

Wie der fliegende Holländer mit seiner untoten Besatzung die Meere, so verunsicherte Christoph Schlingensiefletzthin die Nutzer eines anderen, modernen Verkehrsweges: Er kaperte sich eine U-Bahn und veranstaltete unter Tage freibeuterische Talkshows, die jeden Rahmen sprengten. Seine Gäste – Freaks, Schriftsteller, Schauspieler und andere Komplizen – skandierten Parolen, erlitten Herzattacken und randalierten so leidenschaftlich, dass die Berliner Verkehrsbetriebe erschrocken die Dreherlaubnis zurückzogen. Da war’s schon zu spät, „U 3000“ – angelegt auf acht Folgen – abgedreht und bei MTV auf Sendung, donnerstags um 22.30 Uhr. Nun, nicht ganz. Zum Zeitpunkt dieses Interviews muss noch Material geschnitten werden. Aber Schlingensief will sich seine Aktion nicht von MTV beschneiden lassen. Und MTV will sich sein Programm nicht von Schlingensief beschmutzen lassen. Also haben sie einen Vertrag gemacht, den er jetzt aus der Tasche zieht: „Ich muss dir was zeigen! Hier steht’s!“ Tatsächlich: Christoph Schlingensief muss 1.400 Mark zahlen, wenn er sein eigenes Material schneiden will. So steht’s im Vertrag, lind – Schlingensief verzieht das Gesicht – „die wollen da Heavy Metal drunterlegen!“

Dabei hat der Künstler langjährige Erfahrungen mit verärgerten Geldgebern – sein Geschäft ist eine Provokation, die, könnte man sie reibungslos buchen, schon keine Provokation mehr wäre. Letztes lahr beispielsweise buchte ihn die Deutsche Bank. Das Thema: „Kapitalismus im 21. lahrhundert“. Was könnte es schon schaden, wenn Schlingensief mit seiner Truppe ein bisschen Staub aufwirbeln und Geld aus dem Fenster schmeißen würde? Als der aber ankündigte, tatsächlich und buchstäblich 100.000 Mark aus einem Fenster im Reichstag zu werfen, kündigte die Deutsche Bank erbost die Zusammenarbeit. Und stellte auch gleich das Sponsoring für die Berliner Volksbühne ein, an der Schlingensief regelmäßig Regie führt.
Das Enfant terrible, wie er mit seinen 40 [ahren immer noch genannt wird, empfängt in einer aufgeräumten kleinen Dachwohnung am Prenzlauer Berg. Über dem Sofa hängt eine gewaltige Landkarte, wie man sie aus dem Erdkundeunterricht kennt. Auf dem Tisch liegen vier Telefone und eine Fernbedienung fein säuberlich nebeneinander. Schlingensief muss über den Anblick selbst lachen. Und reden. Nicht gezielt oder dozierend, sondern kreisend, suchend, prozesMedien-Freibeuter
sual, als liefe ständig eine Platte, auf die sich nur noch die Nadel senken muss. Die Fertigung der Gedanken beim Reden – Schlingensief beherrscht diese seltene Kunst mit traumwandlerischer Sicherheit.
Fragt man ihn, den Provokateur, nach MTV, dem kapitalistischen Industriesender, dann sagte er Sachen wie: „Die haben genau so Schwierigkeiten mit mir wie ich mit ihnen. Das ist noch nicht ausgestanden. Wenn es mir nur um eine möglichst große Plattform ginge, dann wäre MTV ideal. Ich will aber haftbar bleiben. Natürlich kann ich mir auf der Bühne oder vor laufenden Kameras in den Kopf schießen oder ein Bein abschneiden, das sieht auch schön spekulativ aus. Aber dann hast du Sendungen wie ‚Reporter‘ oder Brisant‘, die sind schon genauso weit. Wenn nicht weiter.“ Ärgert es ihn denn nicht, wenn etwa „Focus“ schreibt: „letzt ist ihm sogar MTV auf den Leim gegangen“? Schlingensief schüttelt den Kopf: „Um herausfinden zu wollen, wer mir alles noch au} den Leim gehen könnte, bin ich viel zu kleinbürgerlich. Aber eigentlich stimmt der Satz, weil er ja auch beinhaltet: Das, was ich mit MTV mache, kann eigentlich gar nicht klappen. Da fehlt der Clip dazwischen, da fehlt Madonna.“ Statt dessen sahen wir die unsäglichen Jakob Sisters herumsitzen, der Schauspieler Rolf Zacher brüllte Unverständliches, und Schlingensief bemalte sich, wurde zunehmend aggressiv. „Ich bin da ziemlich entblößt, und diesen Reiz der Peinlichkeit kann mir niemand nehmen. Das mit MTV durchzustehen, ist interessant. Letztlich ist es auch ein Llntersuchungsgegenstand. Wenn die jetzt Heavy Metal darunterlegen, muss ich darüber reflektieren, ob das nicht als Steigerung der Peinlichkeit in meinem Interesse sein könnte.“
Auch dies ist sein Metier: Peinlichkeit als Grenzerfahrung, die auf den Betrachter zurückfällt. Ob er nun mit Anhängern seiner Partei Chance 2000 Helmut Kohls Urlaubsgewässer, den Wolfgangsee, zum Liberlaufen bringen will, oder zu Zeiten des Kosovokrieges mit dem Taxi nach Mazedonien fährt – immer scheitert er grandios. Lind agiert genau damit an gesellschaftlichen Grenzen, oszilliert gekonnt zwischen Peinlichkeit und Relevanz. Absurd ist das natürlich immer. Und Schlingensief allemal lieber als leere Worte wie „Kunst, Kultur, Revolution oder Widerstand. Das sind nur operative Begriffe, die nichts bewirken und nur Fronten aufbauen sollen. So gesehen mache ich Fronttheater.“
Das übte der Apothekerssohn aus Oberhausen an der Ruhr schon als Schüler. Mit einer Super-8-Kamera drehte er erste Filmchen. Nach dem Abitur bewarb er sich zweimal an der Münchner Filmhochschule. Vergeblich. Also studierte er lustlos fünf Semester lang Kunstgeschichte, Germanistik und Philosphie, arbeitete aber nebenher als Kamera-Assistent und an eigenen Kurzfilmen. Ende 1982 lernte er den Experimentalfilmer Werner Kekes kennen und drehte unter dessen Einfluss seinen ersten Spielfilm: „Tunguska – Die Kisten sind da“. Dem folgte Bizarres wie „100 lahre Adolf Hitler“ und „Das deutsche Kettensägenmassaker“. Inzwischen hatte er als erster Aufnahmeleiter der „Lindenstraße“ wahrhaft „grauenvolle Erfahrungen“ gemacht. Und herausgefunden, dass er keine linearen Geschichten erzählen konnte und wollte.
Mit seinem Debüt an der Volksbühne 1993 war Schlingensief dann fast angekommen – beim politischen Aktionstheater, wo er bevorzugt mit Laien oder Behinderten spielte. Sein Stück „100 lahre CDU – Spiel ohne Grenzen“ provozierte teils Begeisterungs-, teils Proteststürme. Was auch daran liegen könnte, dass sein Theater nie Selbstzweck, sondern immer nervöse Meditation über Deutschland und Gesellschaft ist. Ein Beispiel: Schlingensiefs „absolutes Lieblingsbuch“ ist „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ von Friedrich Nietzsche. Obwohl es von der Fachwelt 1872 totgeschwiegen wurde, schrieb ein begeisterter Richard Wagner: „Schöneres als Ihr Buch habe ich noch nichts gelesen.“ Lind unter dem Motto „Wagner lebt – Sex im Ring“ tingelte Schlingensief dann im Herbst 1999 durch die Provinz, ließ Wagners „Walkürenritt“ aus den Lautsprechern schallen und Kommentare von Wagner verlesen – von Franz Josef Wagner, dem sagenumwobenen Journalisten und Kolumnisten. So funktioniert grenzsprengende Vernetzung im Schlingensiefschen Sinne.
So ernst er Nietische nimmt, so wichtig ist ihm die Musik als Schlüssel zu einem „ganz und gar nicht esoterisch“ erweiterten Bewusstsein. Nicht einlullen soll Musik, sondern öffnen. Das klappt selten: „In dem Moment, wo man sie hört, kann man sich den Grundtenor der Bilder vorstellen und ist fremdbestimmt. Musik funktioniert als Transmitterstoff, der durch die Botschaft in der Musik immer so hanebüchen scheiße wird. Du merkst immer sofort, wenn einer mit seiner Musik etwas sagen will. Bei den Sternen dagegen gibt’s Texte, die mit der geschliffenen Musik im Hintergund gut funktionieren. Ich kenne das sonst nur von FSK. Thomas Meinecke hat gewisse spleenige Vorlieben entwickelt, die er mit scheinbar ziellosen Texten konterkariert.“ Und: „Musik ist keine Droge. Sie ist ein Transportmittel.“ Daher hört er sie am liebsten beim Drehbuchschreiben – weil sie etwas auslösen kann.
Warum aber flirtet ausgerechnet der „Hofnarr der Republik“ („Spiegel“) mit dem denkbar unpolitischen MTV-Publikum? „Weil das wieder so eine Frontstellung ist, die nicht mehr gilt. Wie die bequeme Lüge, alles sei Pop. Im Gegenteil: Ich verachte Kasper wie Stefan Raab, der sich seine Gegner immer so arrangiert, dass er sich mit ihnen einigen kann. Es ist auch besser, mit einem Arschloch wie Horst Mahler (Ex-RAF- und heutiger NPD-Anwalt, Anm.d.Red.) zu streiten, statt zu erklären: Mit dem rede ich nicht. Das bringt nichts. Die Kids“, findet Schlingensief, „die machen das, die zappen quer. Die können heute mit Informationen viel besser umgehen, als manche sich das vorstellen können“.
Dann klingelt eines der Telefone. Es geht um Weihnachten, das er mit den Eltern seiner netten Freundin in Tirol verbringen möchte: „Ich will, dass meine Eltern auch kommen. Noch so ein Weihnachten wie letztes Mal in Oberhausen, das halte ich nicht aus“, sagt er: „Meine Eltern können nicht mehr differenzieren, die sind auf dem Weg in die Steinzeit. Die sehen mich auf MTV, wie ich die Hosen runterlasse, und sagen: ‚Dass du uns das vor unserem Tod noch antun musst‘. Ich schreibe eigentlich nur für die Frankfurter Allgemeine, um meine Eltern zu beruhigen.“
Klagen, Attentate, Tritte, Schläge und Gespött kann er wegstecken, ist alles schon da gewesen. Wovor Christoph Schlingensiefsich wirklich fürchtet, ist Stillstand: „Ich kenne so viele Typen, auch in der Presse, die mal so richtig auf den Putz gehauen haben, die für zwei, drei, sechs lahre den Ton angegeben haben. Und dann schreiben sie plötzlich, wie sie sich auf dem Weg ins Theater den Fuß verknacksen, wies dann noch anfängt zu regnen und blablabla…“ Er schüttelt den Kopf, fahrt sich durch die strubbeligen Haare, unter denen schon ein paar Graue sind, und sagt mit seltsamer Gewissheit: „Das kann mir nicht passieren.“