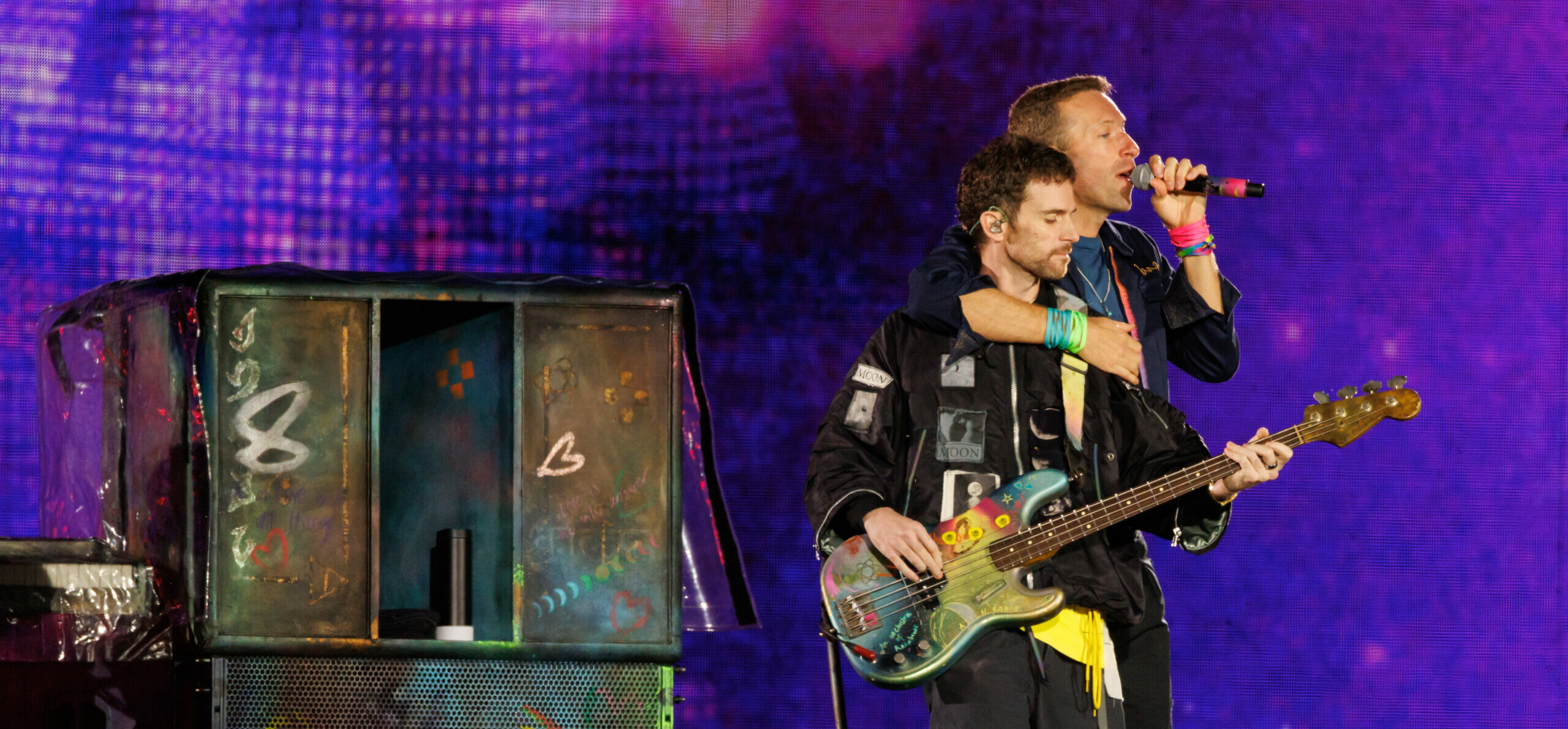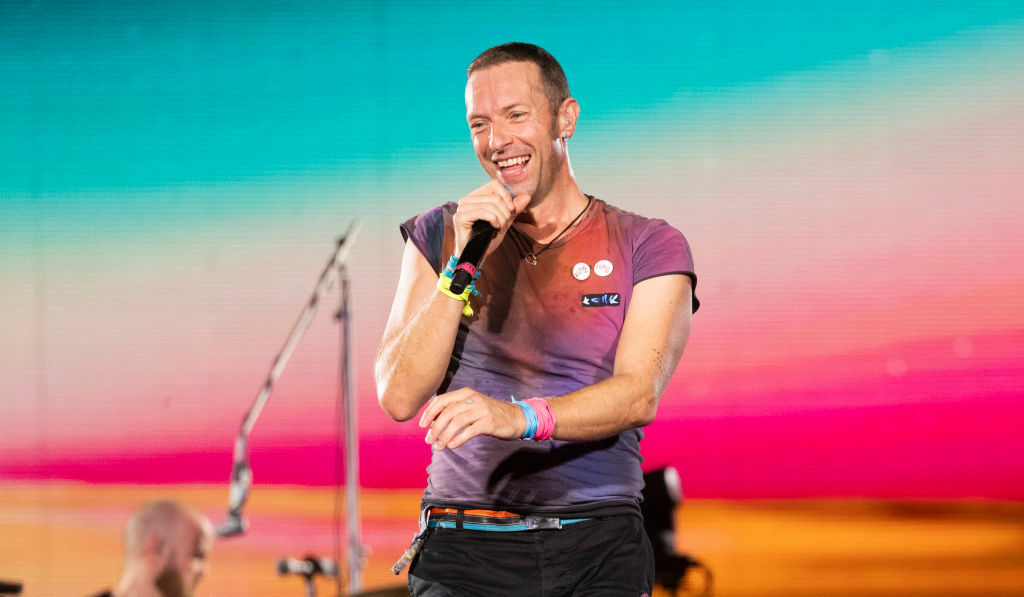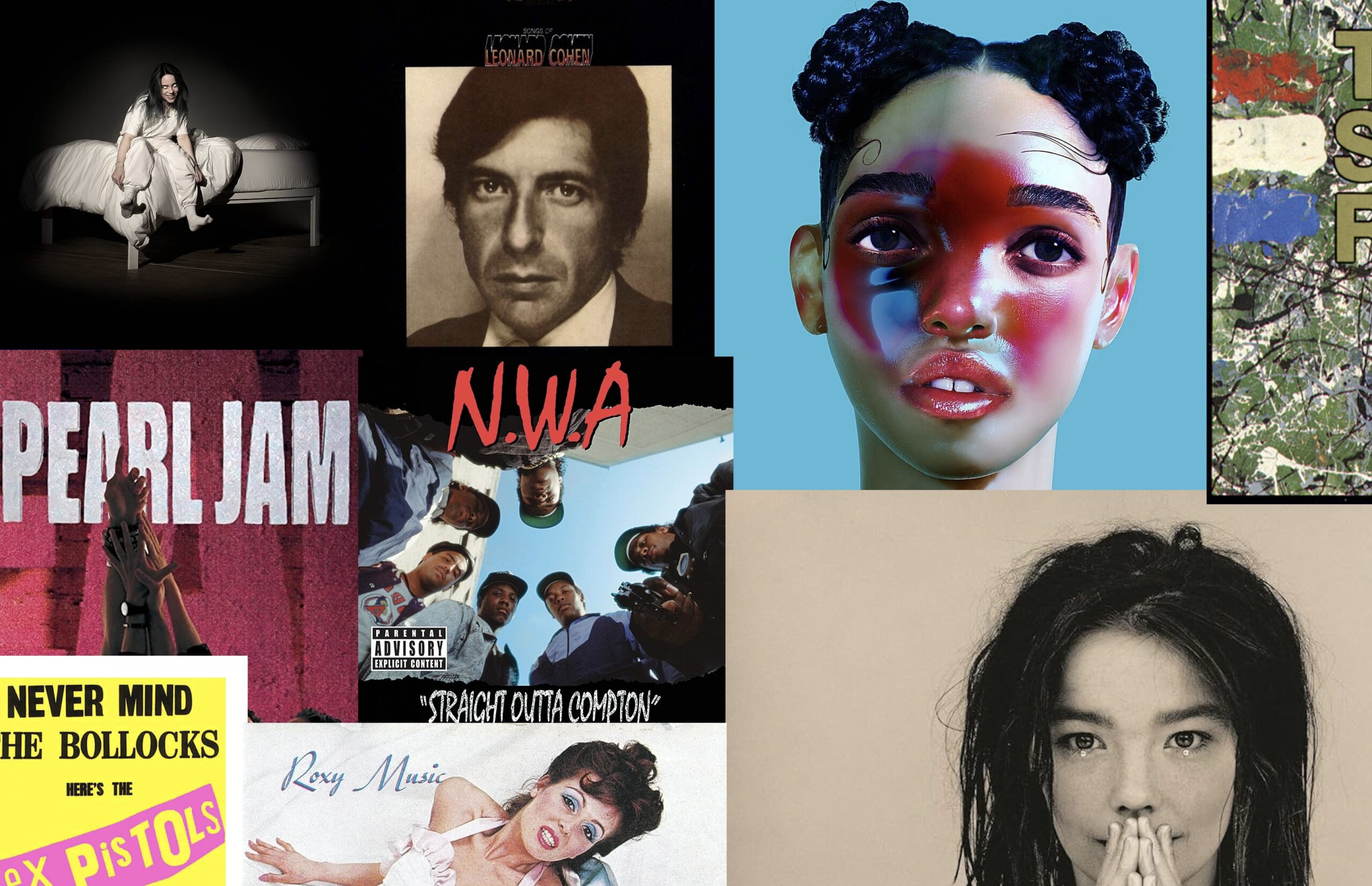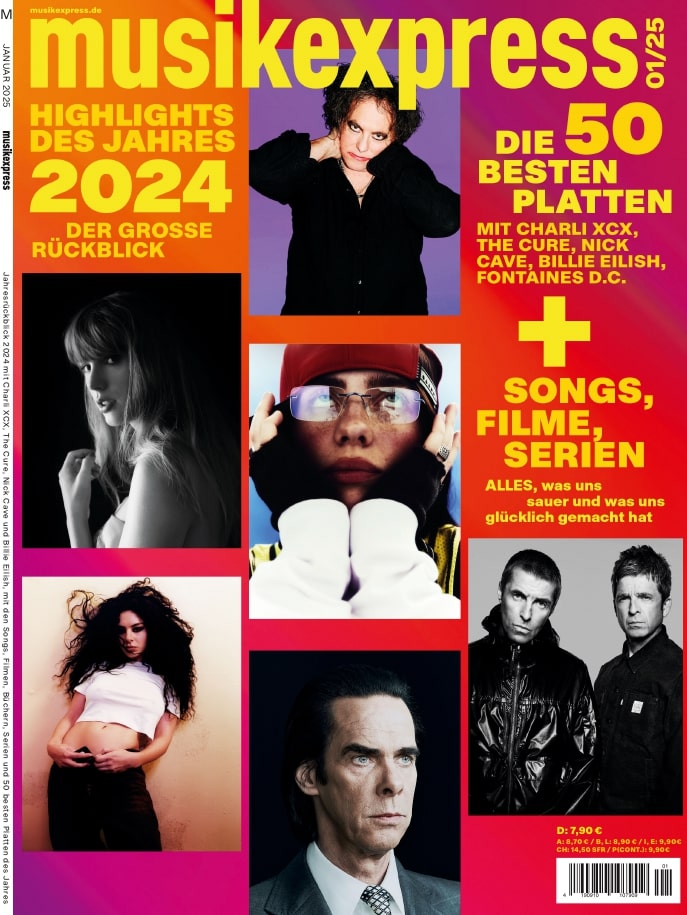Clawfinger
Ihre Musik ist hart und heftig, aber persönlich sind die Skandinavier eher nachdenkliche und zurückhaltende Naturen
„Natürlich sind wir stolz auf die Erfolge von Abba, Roxette und Ace of Base“, verkündet Gitarrist Erlend Ottern ohne jede Ironie, „schließlich beweist das immerhin, daß Popmusik aus Schweden weltweit geschätzt wird!“ Dabei sind Ottern und seine Band Clawfinger nicht gerade für lieblich-poppige Ohrwürmer, sondern für rapiden Rock mit Rap-Einlagen bekannt. Aber Nationalstolz geht den Nordlichtern nun mal vor Abgrenzung. „Wir haben immer wieder unsere Auseinandersetzungen. Vor allem bei Fußball-Länderspielen zwischen Norwegen und Schweden“, ergänzt Ottern, denn er und Keyboarder Jocke Skog sind Norweger, während Sänger Zak Tell und Gitarrist Bard Torstensen aus Schweden stammen. Alle vier geben als Hauptwohnsitz Stockholm an, aber viel haben die sie von ihrer Heimatstadt, zumindest im vergangenen Jahr, nicht gesehen. „Die Hälfte der Zeit waren wir auf Tour, dazu kamen Festival-Einsätze und Interview-Reisen“, sagt Bard Torstensen.
Clawfinger sind sich bewußt, daß man stets am Ball bleiben muß, um im rauhen Business zu bestehen. Bislang können sie jedenfalls nicht klagen. Die Karriere der Band trägt fast schon märchenhafte Züge. Die vier Ex-Punks, die heute alle um die 30 sind, lernten sich 1993 im Stockholmer Rosenlund-Hospital kennen, wo sie als Krankenpfleger jobbten. Nach nur einer Indie-Single bekamen sie einen Major-Plattenvertrag. Ihr erstes Album wurde 1993 weltweit veröffentlicht und setzte sich sogleich in fast allen europäischen Charts fest. Der eingängige Sound von ‚Deaf Dumb Blind‘ bezauberte sowohl Metal- wie Hardcore-HipHop-Fans. Es ist besonders der schneidende Klang der Gitarren, der Clawfinger so leicht identifizierbar macht. „Wir stehen nicht so auf diese Marshall-Verstärker-Rock-and-Roll-Attitüde“, erklärt Ottern, „das ist völlig altmodisch. Also haben wir die Gitarren im Studio direkt ans Mischpult angeschlossen, was für einen cleanen, fast elektronischen Sound sorgt“. Die hypnotische Stimme von Zak Tell tut ein Übriges. Sie setzt ihrem typischen Sound die Krone auf.
Beim neuen Album ‚Use Your Brain‘ sind die Skandinavier auf Nummer Sicher gegangen und haben in die gleiche Kerbe gehauen wie auf ihrem Erstling. „Es ist wie im Fußball: Never change a winning Team“, meint Erlend Ottern lachend dazu. Der Albumtitel klingt zunächst mal wie eine Plattitüde, aber die Band meint es ernst mit ihrer Message: „Es ist gar nicht so selbstverständlich heutzutage, daß die Leute darüber nachdenken, was sie tun und was ihnen so vorgesetzt wird“, meint Ottern. „Es ist immer unbequemer, sich mit den Dingen auseinandersetzen zu müssen, als sich treiben zu lassen. Als junger Mensch gerätst du heute so leicht unter fremden Einfluß, daß sich die Aufforderung, das Gehirn in Gang zu setzen, schon lohnt.“
Natürlich sind auch die Texte von Clawfinger derart gehalten. Auf der ersten Single ‚Nigger‘ ging es ihnen um Rassendiskriminierung. „‚Nigger‘ ist nicht als Beitrag zur Diskussion über amerikanischen Rassismus mißzuverstehen. Hier in Schweden haben wir genügend eigene Probleme mit Nazis und Rassisten. In Stockholm gibt es fast täglich Überfälle auf schwarze Einwanderer!“, erzählt Ottern. Auf ‚Use Your Brain‘ findet sich zum Beispiel der Song ‚Do What I Say‘, auf dem ein zehnjähriger Junge im Refrain intoniert, daß – wenn er mal groß ist – alle tun müssen, was er befiehlt. „Das spielt auf die Unterdrückung durch die Eltern an. Wenn Kids zu autoritär erzogen werden, fangen sie an, diese Strukturen zu übernehmen und später geben sie diesen Bullshit an ihre eigenen Kinder weiter. Ein Teufelskreis!“ Hatten die Musiker von Clawfinger im – als liberal bekannten Skandinavien selbst unter diktatorischen Eltern leiden müssen? „Kann man nicht sagen“, schränkt er ein. „Wir stammen alle aus relativ liebevollen Mittelklasse-Verhältnissen, können uns bei unseren Anklagen also nicht auf eigene Erfahrungen, sondern nur auf Beobachtungen stützen.“
Der radikale Sound der Band steht in krassem Widerspruch zum Auftreten der Musiker. Alle vier Clawfingers sind umgängliche, fast zart besaitete Leute. „Das kann man schon fast ein Minderwertigkeitgefühl nennen, was wir da gegenüber sogenannter Street-Musik entwickelt haben“, sagt Zak Tell. „Die Punk Rocker Englands in den späten Siebzigern stammten ja überwiegend aus der Arbeiterklasse, und die amerikanischen Rapper sind meistens irgendwelche Ghetto-Typen, die nie eine Chance bekommen hätten, wenn sie nicht Musiker geworden wären. Aber ihre Aggression und Kompromißlosigkeit können wir nachvollziehen“. Wie sich das für Musiker gehört, wollen Clawfinger keinesfalls in eine Schublade geschoben werden, auch wenn es hauptsächlich die Metal-Presse war, die zuerst ihr Herz für die Band entdeckte. „Wir sind sehr genau bei der Auswahl von Bands, mit denen wir auf Tour gehen. Da landet man schnell auf der falschen Baustelle.“
Anthrax und Alice In Chains waren ihnen schließlich gut genug, um sie auf ihren Europa-Reisen zu begleiten. „Mit Bon Jovi oder Aerosmith würden wir nie touren“, wehrt Erlend Ottern energisch ab, „die werden ja seltsamerweise auch in die Metal-Ecke gestellt, aber mit solchem Zeug wollen wir sicher nie verwechselt werden“. Ein Abenteuer liegt noch vor Clawfinger. Bislang waren sie noch nie in den USA, kennen aber die Herausforderung der Neuen Welt. „Klar, 1995 ist Amerika fällig. Aber wir wissen: es wird schwer!“.
Clawfinger sind Realisten genug, um genau zu wissen, daß der Beruf Rock-Musiker in aller Regel keine Lebensstellung darstellt. „Natürlich wird es die Clawfinger irgendwann mal nicht mehr geben“, meint Ottern, „aber ich will mich hier und jetzt einfach noch nicht mit der Zukunft beschäftigen. Nur eines weiß ich sicher: Als Krankenpfleger werde ich nie im Leben wieder anfangen!“.