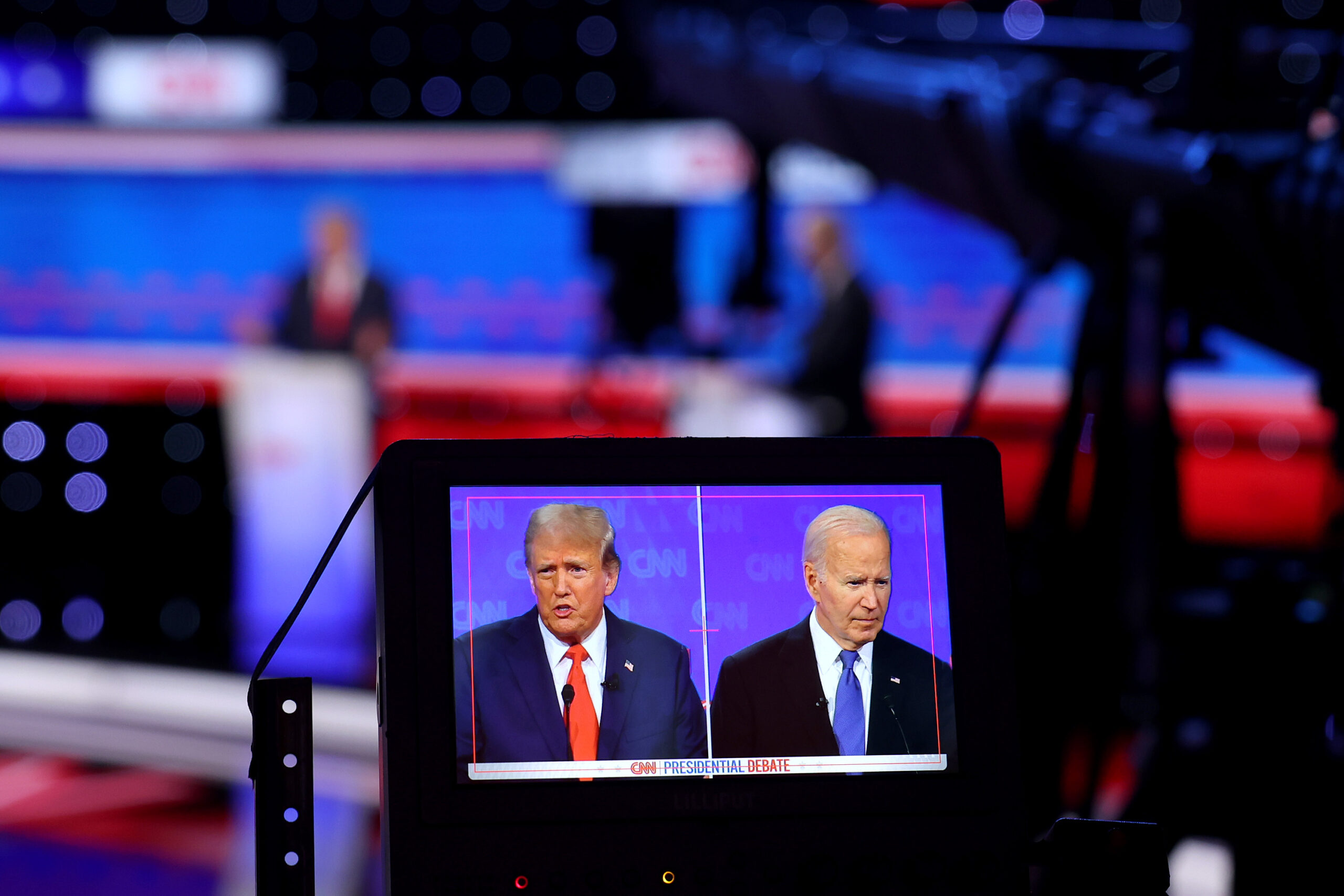Die Biestig Boys
Im wahrsten Sinne des Wortes, ein bunter Hund, dieser Fred Durst. Bis vor einigen Jahren noch ein Nobody aus der US-Provinz, zählen der Ex-Tätowierer und seine Band inzwischen zu den heißesten Acts in Amerika. Und nun lauern Limp Bizkit auf den ganz großen Erfolg. MUSIKEXPRESS sagt, mit wem wir es zu tun bekommen.
Der Kollege kennt sich aus: „In der Kaufingerstraße laufen die ersten Typen schon so rum“, weiß der Mann mit dem wachen Auge und deutet auf das Foto von Fred Durst. Die Kaufingerstraße liegt im Zentrum von München und ist so etwas wie die Zeil in Frankfurt oder die Hohe Straße in Köln – eine Einkaufsmeile, auf der man alles bekommt, was man im Grunde gar nicht braucht. Dafür sieht man aber eine Menge interessanter Menschen. Neuerdings eben auch solche, die aussehen wollen wie Fred Durst. Der Boss von Limp Bizkit hat nämlich ein Markenzeichen: eine rote Mütze, die ihm vorn bis zu den Augenbrauen und an der Seite bis zu den Ohren reicht. Und weil der Besitzer dieser Kopfbedeckung ein Popstar ist, noch dazu einer aus Amerika, möchten manche sein wie er. Ein mindestens fragwürdiges, auf jeden Fall aber wenig erstrebenswertes Ziel.
Doch immer schön der Reihe nach: Um den Bekanntheitsgrad von Fred Durst und den Seinen auch diesseits des Atlantiks noch zu steigern, hat die Plattenfirma von Limp Bizkit nach Los Angeles eingeladen. Hübscher Trip, möchte man meinen, wenn, ja wenn da nicht dieser schier endlos lange Flug wäre und Stewardessen mit dem Charme von Gouvernanten aus dem viktorianischen England. Immerhin, gegen Mitternacht ist man im Hotel. Müde zwar, aber trotzdem guter Dinge, weil man ja am darauffolgenden Mittag Fred Durst treffen darf. Und toll organisiert ist der Arbeitsausflug auch noch. Das Studio, in dem Limp Bizkit Hofhalten, ist vom Hotel aus zu Fuß in gerade mal 20 Minuten zu erreichen – unter kalifornischer Sonne ein Spaziergang mit Urlaubscharakter. Den Stenoblock mit den Prägen in der einen, das mit frischen Batterien bestückte Aufnahmegerät in der anderen Jackentasche meldet man sich am Empfang der Sir-Studios, 6465 Sunset Boulevard. Ein rechteckiger Zweckbau, der durch nichts, aber wirklich gar nichts verrät, dass sich hier Größen aus Rock und Pop die Klinke in die Hand geben.
Wie zum Beispiel heute Fred Durst und seine Bizkit Boys – wenn sie denn da wären. Der freundliche Mensch am Empfang („ach, sie kommen aus Deutschland, weiter Weg“) weiß zumindest, „dass die Jungs dieser Tage mal hier waren. Proben oder so. Aber heute, nein, keine Ahnung.“ Nun ja, liegt vielleicht daran, dass der Reporter ein bisschen zu früh dran ist. Denn erstens ist man Deutscher, und zwar mit allen preußischen Folgeerscheinungen, und zweitens möchte man Popstars nicht mit Verspätung unter die Augen treten, von wegen time is money oder so. Also übt sich der Reporter in Geduld. Ne halbe Stunde, ’ne Dreiviertelstunde, ’ne Stunde. Dann ist endgültig Schluss mit preußischer Disziplin – Hintern hoch und reingeguckt in alles, was ’ne Tür hat. Mit dem Ergebnis, dass der Mann von MUSIKEXPRESS feststellen muss, dass er ganz offenbar zur richtigen Zeit am falschen Platz ist. „Ja“, bestätigt ein freundlicher Herr am anderen Ende der Telefonleitung, wo angeblich das Management von Limp Bizkit seinen Sitz hat, „an der Planung der Interviews hat sich was geändert.“ Genaueres wisse die Plattenfirma. Stimmt. Das US-Department der Bizkit-Firma teilt auf Anfrage mit, dass die Interviews in den Sir-Studios abgesagt worden seien. Genaueres wisse eine aus Deutschland angereiste Kollegin. Stimmt auch. Die PR-Dame aus Hamburg nämlich teilt unserem Berichterstatter mit, dass es in Los Angeles gar kein Interview mit Mr. Durst oder sonst einem Bizkit gebe. Die Band habe kurzfristig umdisponiert, und nun wolle man sich in San Francisco treffen. Abflug: morgen früh, sieben Uhr oder so. Die Limps seien waaahnsinnig beschäftigt, hätten demzufolge wenig Zeit, und man wolle früh mit den Interviews beginnen. Kein Problem. Für die Herren Popstars steht man doch gern mal mitten in der Nacht auf. Am nächsten Tag dann ist die kleine Reisegruppe, paar Journalisten, deutsche Plattenfirmenfrau, amerikanische Plattenfirmenfrau, puertorikanischer Minibusfahrer, pünktlich in San Francisco. Dort sollen Limp Bizkit bei einem Open-Air-Festival im Shoreline Amphitheater auftreten. Durst und Kumpane sind die Headliner. Auftrittsbeginn: kurz vor Mitternacht. Kein Grund also für die Band, den Ausflug in Promotion-Arbeit ausarten zu lassen. Ihr luxuriös ausgestatteter und natürlich voll klimatisierter Bus rollt am frühen Nachmittag aufs Festivalgelände. Dass sich dort schon seit Stunden ein paar Journalisten die Beine in den Bauch stehen und die Interviews, wegen der sie angereist sind, langsam aber sicher abhaken, wen interessiert das schon. Star ist Star, und Schreiberling ist Schreiberling, so schlicht funktioniert die Durst’sche Rockerlogik. Das geht sogar der deutschen Plattendame, unter diesen Umständen ein wahrhaft bemitleidenswertes Geschöpf, zu weit.
So was habe sie ja noch nie erlebt, schimpft sie, und überhaupt sei den Amis die deutsche Delegation ja wohl scheißegal. Stimmt nicht. Denn irgendwann am Nachmittag, jedenfalls etliche Stunden nach dem geplanten „frühen Arbeitsbeginn“, wird zumindest der MUSIKEXPRESS zum Interview gebeten. Nicht mit Bizkit-Boss Fred Durst zwar, so aber doch immerhin mit Gitarrist Wes Borland. Der 25-Iährige hat eine dunkelhaarige Lady im Schlepptau und wirkt völlig entspannt im Hier und Jetzt. Guter Zeitpunkt also, ein paar sorgsam ausgearbeitete Fragen zu stellen. Stört es ihn, den Herrn Borland, eigentlich nicht, dass mit dem Namen Limp Bizkit immer nur die Nase von Fred Durst in Verbindung gebracht wird? „Nein“, fällt die knappe Antwort aus. Haben wir Wes etwa auf dem falschen Fuß erwischt? War die erste gleich die falsche Frage? Neuer Ansatz: Hat er, Wes, mit Millionen verkaufter Platten und internationalem Erfolg sein ganz persönliches Lebensziel erreicht? Die Antwort wirkt wohlüberlegt, aber nicht zögerlich: „Was das Berufliche betrifft, habe ich fast mehr erreicht, als ich mir je hätte träumen lassen. Das Private ist natürlich eine andere Sache.“ Und was für eine, möchte der lästige Reporter mit Blick auf die schweigsame Begleiterin von Wes Borland wissen. Das gehe niemanden etwas an, sei allein seine Sache und sowieso nicht besonders spannend, antwortet Wes und macht einen leicht frustrierten Eindruck.
Grund genug, ein wenig weiterzubohren. Und ob das Private die Leute was anginge, hält der Mann von MUSIKEXPRESS gegen. Immerhin sei ein Popstar eine Persönlichkeit von öffentlichem Interesse, und da sei es doch nur natürlich, dass man mehr wissen wolle als nur den Namen der nächsten Platte (die heißt übrigens „Chocolate Starfish and the Holdog-Flavored Waler“ und soll noch in diesem Herbst erscheinen). Das öffentliche Interesse an seiner Person, speziell die Arbeit der Medien, kommentiert Borland ebenso deutlich wie ruhig: „Egal, was man auf ihre ganzen Fragen antwortet, die Presse schreibt doch sowieso, was sie will. Diesen Leuten geht es doch nur darum, ihre Blätter zu verkaufen. Ob sie dabei die Gefühle anderer Menschen verletzen, ist denen doch scheißegal.“ Stimmt nicht, widerspricht der Berichterstatter und untermauert seine These mit der Tatsache, dass er einen ziemlich weiten Weg zurückgelegt habe, um mehr über Limp Bizkit zu Tage zu fördern als die üblichen Stereotypen von den rüpelhaften Rap-Metallern aus USA.
Der Protest fruchtet wenig, das Gespräch, so es denn überhaupt eines ist, gerät ins Stocken. Da trifft es sich, dass genau in diesem Moment der Boss von Limp Bitkit den chromblitzenden Doppelachser betritt. Voilà: the man himself. Fred Durst, 29 lahre alt, jetzt schon Millionär, aber nach eigenem Bekunden längst noch nicht am Ziel seiner Träume. Durst möchte ein Mogul sein im kalten Geschäft mit der heißen Ware Unterhaltung. Dafür schuftet er 16 Stunden am Tag, haut sich die Nächte in Studios um die Ohren, denkt sich Videos aus, setzt sie um, freut sich über die bewegten Bilder und versucht demzufolge, auch im Filmbusiness Fuß zu fassen. Am liebsten hätte der armtätowierte Ehrgeizling seinen eigenen Konzern, sein eigenes Unterhaltungsimperium. Das US-Magazin „Spin“ charakterisiert Durst mit diesen Worten: „Macht und Ruhm üben eine immense Anziehungskraft auf ihn aus.“ Eine Einschätzung, die jeder teilt, der Fred Durst von Angesicht zu Angesicht begegnet. Der Mann strahlt schon Energie aus, wenn er im Band-Bus auch nur die opulente Stereoanlage einschaltet; alles schnell, alles zackig, alles effizient. Kein Wort zuviel, schon gar nicht zu lästigen Besuchern aus Deutschland. Die vier Worte „Do you like it?“ wirken da fast schon wie eine mittlere Ansprache. Und als Frage sind sie schon gar nicht zu verstehen. Denn „Do you like it“ bezieht sich auf einen Track vom neuen Album der Bizkits. Und Meinungen oder Ansichten von Außenstehenden sind in diesem Zusammenhang nicht gefragt. Allenfalls Bestätigung.
Aber klar doch, Fred, super Nummer. Bisher so ziemlich das Beste, was ihr abgeliefert habt.“ Das sind die Worte, nach denen Durst durstet, wenn es um die Musik seiner Band geht. Und das sind auch die Worte, die er bei unserem denkwürdigen Treffen im Tourbus zu hören bekommt. Denn Fred ist mit Mädels aufgekreuzt. Die tragen knallenge Röcke, sind bestens bepackt und ziemlich blond. Solche Menschen widersprechen nicht, solche Menschen himmeln an. Karl der Große ist hier kein Thema und wohl auch wenig bekannt. Fred der Große dagegen schwebt hier über allem – ein kleiner Mann, der es zum großen Popstar gebracht hat, Haus in Beverly Hills und fetter Mercedes inklusive. Der Lebensstandard von Fred Durst hat sich gegenüber früher deutlich verbessert, sein Umgangston dagegen nicht. Kaum ein Satz, der ohne ein deftiges „fuck you“, „fuck it“, „fuck that“ auskommt und Fred als wahren Biestig Boy zu erkennen gibt. Dennoch: Die Schönen und Reichen von Hollywood mögen den ruppigen Metalrapper mit der roten Mütze. „Fred Durst hangs out with the Hollywood A-List“, formulierte ein US-Blatt nicht ohne Anflug von mildem Erstaunen. Vor seinem Leben als Popstar jobbte Durst auch schon mal als Kellner oder in einem Tattoo-Shop. Jetzt ist er reich und möchte, Amerikaner durch und durch, es auch zeigen. So verriet er unlängst dem britischen „New Musical Express“: „In der HipHop-Welt sieht man es nicht so gerne, wenn du dich für deine Leistungen selbst belohnst. Für mich aber ist ein Traum wahr geworden. Ich wollte mich belohnen, ich wollte ein Haus haben, und ich wollte mir ein Auto kaufen.“ Inzwischen hat er beides. Bloß die Umgebung sagt ihm laut dem englischen Musikblatt „Select“ nicht zu: „In Los Angeles fühl‘ ich mich wie ein verfickter Außenseiter. Ich wohne nur da, damit ich meine Träume verwirklichen kann. Los Angeles ist völlig hohl. Es ist voll von selbstmitleidigen Motherfuckers. Und voll von einer Menge Leute, wie ich es bin. Leute, die nur hier sind, um ihre Sachen zu erledigen. Wir leben hier hundserbärmlich. Ich werde diesen verfickten Ort so schnell verlassen, wie es nur geht.“ Bloß, so schnell wird das kaum gehen. Immerhin hat Dursts amerikanische Plattenfirma, Interscope, den Mut besessen, den cleveren Selfmademan Fred zu ihrem Vizepräsidenten zu ernennen. Ob nun, weil er so ein enormes Ver- und Einkaufstalent ist oder aber der Mozart unter den Rap-Metallern, sei einmal dahingestellt. Fest steht: Der Glitzer-Metropole Los Angeles wird Durst nicht so schnell entkommen. Immerhin, in L.A. kann Fred seine Träume verwirklichen und zudem noch mehr Geld machen. „Geld?“, fragt er in „Select“, „ich habe mein Leben auf der Straße gelebt, ohne Geld. Jetzt lebe ich mein Leben mit Geld. Es ist exakt die gleiche verfickte Sache. Außer vielleicht, dass du mit Geld eine Menge zusätzlicher Scheiße am Hals hast – zum Beispiel, dass du dich nicht mehr entspannen kannst.“ Armer reicher Rockstar also? Mit Sicherheit nicht. Denn dafür hat Durst denn doch zu hart für den Erfolg gearbeitet. Aufgewachsen in Gastonia, US-Bundesstaat North Carolina, und in Jacksonville, einem Flottenstützpunkt an der Küste Floridas, hatte Fred mit 14 die erste Begegnung mit dem Rap – was damals nicht eben positiv aufgenommen wurde. „Die Leute da nannten mich ‚Nigger-Lover'“, erinnert Durst sich in „Spin“, „und ein ‚Nigger-Lover‘ war zu dieser Zeit jemand, den die anderen Kids gehasst haben.“
Nach der High School absolviert Durst eine Pflichtübung bei der Navy, heiratet, wird Vater seiner inzwischen achtjährigen Tochter Adriana – und lässt sich scheiden. Nach und nach lernt er die Mitglieder seiner heutigen Band kennen (siehe „Fette Jahre“ auf Seite 23; Anmerkung der Redaktion). Das Schicksal nimmt seinen Lauf – und meint es gut mit Fred Durst. Meistens jedenfalls. Als die üblichen Anlaufschwierigkeiten erst mal bewältigt sind, gewinnt die Karriere von Limp Bizkit schnell an Fahrt. Heute zählen Durst und seine lärmende Truppe in den USA zu den Top-Acts schlechthin. Und auch hierzulande werden Limp Bizkit immer beliebter. So beliebt immerhin, dass deutsche Musikfans zumindest um den Kopf herum so aussehen möchten wie Fred Durst. Und wenn dann – spätestens zur neuen Platte – in Frankfurt oder in Köln oder in München noch mehr junge Menschen mit roten Mützen herumrennen, dann ist Fred Durst seinem Ziel ein weiteres Stück nähergekommen. Dann besitzt er noch mehr Einfluss und ist fast schon so etwas wie ein kleiner Mogul. Und vielleicht kann er sich dann ja auch mal wieder entspannen.