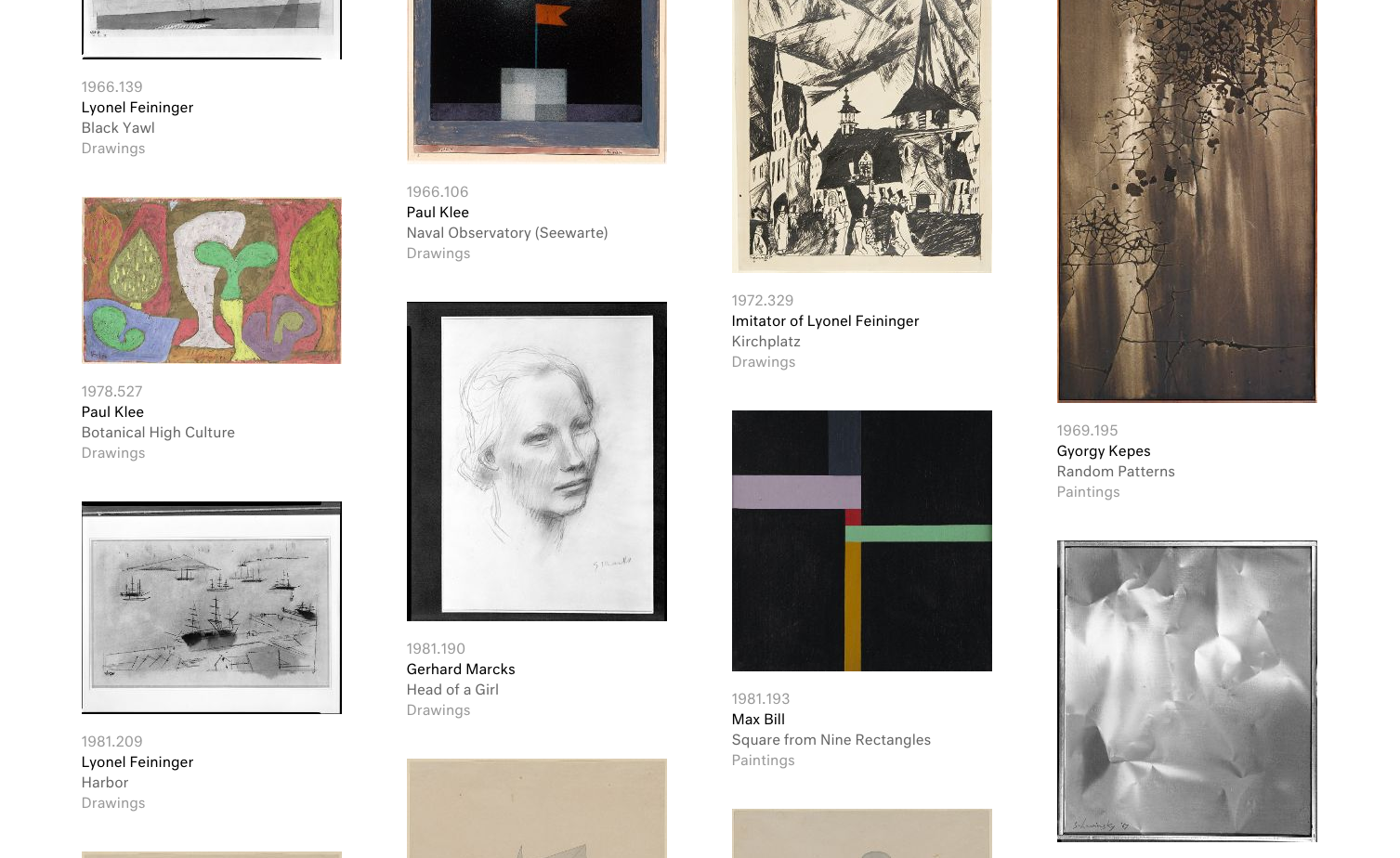Prince, der Sexy Motherfucker!
Zum Tod von Prince: Unser ME-Helden-Geschichte über den „sexy motherfucker“ aus dem April 2014 in voller Länge.
Vor wenigen Jahren rebellierte Prince noch gegen das Unvermeidliche. Er schaltete seine Fanclub-Homepage LotusFlow3r.com ab, die Interessiere für 77 Dollar in ein seltsames Reich aus virtuellen Planeten führte. Auch kündigte er an, nie und nimmer seine Musik iTunes zur Verfügung zu stellen. „Warum sollte ich das tun, wenn diese Leute mich nicht im Voraus dafür bezahlen?“ Heute finden sich dort die meisten Alben; auch über die herkömmlichen Streamingdienste kann man Prince hören – zwar nicht alles, aber doch genug.
Die eigentliche Sensation folgte schließlich im August 2013: Prince twittert, Twittername: @3rdeyegirl. Meistens ist er sehr witzig; die schönste Zwitscherei bislang: „1st selfie #selfie“, dazu ein Bild mit Rauch. Es durfte gerätselt werden: Ist Prince Schall und Rauch? Herrlich, ein Musiker, der in Rätseln twittert. Versuche, in allen Belangen Klarheit zu schaffen, gibt es heute mehr als genug. Die ständige Suche nach Authentizität nervt. Darum lieben wir Prince, den – nach Michael Jacksons Tod – letzten männlichen Pop-Superstar dieser Erde.
Immer schön Gitarre üben
Ein Superstar wird man nicht nach einer geglückten PR-Kampagne oder weil Manager oder Magazine das so wollen. Dazu gehört schon mehr. Zum Beispiel eine segensreiche frühe Karrierephase, in der sich idealerweise alles um die Musik drehte. Als Prince Rogers Nelson, geboren 1958 in Minneapolis, die letzten Monate auf der High School verbrachte, spielte er mit ein paar Kumpels in einer Band, die sich mal Grand Central, mal Grand Central Cooperation nennte – den Tick mit den Namen hatte er damals schon. Sein erstes Interview gab das musikalische Talent 1976 dem lokalen High-School-Magazin.
Mit halbwegs gepflegtem Afro posierte er für das Foto am Klavier, der Blick halb schüchtern, halb verwegen, der Hemdkragen steif. Sagen wir so: Bill Cosby hätte ihn zwar nicht gleich aus dem Haus geschmissen, wenn er in der Show an der Hand seiner Serien-Tochter Denise Huxtable aufgetaucht wäre. Aber ein paar bohrende Fragen hätte er dann doch gestellt.
Im Interview wird der junge Mann brav als Multiinstrumentalist gelobt, und Prince hält einen Ratschlag für alle Leser parat: Immer schön Gitarre üben, vor allem die Bluestonleiter, denn die ist sehr wichtig. Als Prince dann ein Jahr später seinen ersten Plattenvertrag bei Warner unterschrieb, warnte sein Manager Owen Hunsey, die Leute aus Princes Heimstadt Minneapolis sollten nun bitte nicht erwarten, ihr lokaler Held werde in Windeseile ein Überflieger. Hunsey: „Er ist zwar ein echtes Talent, er wird seinen Weg machen. Aber auf das Wort ,Star’ würde ich lieber verzichten.“
FOR YOU als Sound-Grundstein
Das Debütalbum „FOR YOU“ war dann auch kein krachender Erfolg. Wobei: 150.000 LPs gingen in den USA über den Ladentisch, heute wäre es ein Hitalbum, damals blieb es ein Achtungserfolg: Platz 163 in den Billboard-Charts. Wenn man „FOR YOU“ heute auflegt, fallen einige Dinge auf: Die Texten waren vergleichsweise brav, Prince sang Liebesbeschwörungen in klassischer Soul- und Funk-Manier, am direktesten kommt „Soft And Wet“ daher, mit einem Gegenüber so weich wie ein gezähmter Löwe, so feucht wie ein abendlicher Regen: Lyrische Pixi-Bücher im Vergleich zudem, was schon bald folgen sollte. Die Musik hingegen legt schon eine richtige Fährte. Auch wenn die guten Songs noch fehlen, legt Prince auf „FOR YOU“ den Grundstein für seinen Sound.
Kurz gesagt: Prince erfindet 1978 den R’n’B für die 1980er. Er verzichtet bei der Instrumentierung auf Soul- und Funkstandards, stattdessen simulieren Gitarren und Synthesizer die Bläsersektion. „Wir hatten eigentlich vorgehabt, echte Bläser einzusetzen“, sagte der junge Klangpionier kurz nach der Veröffentlichung. „Aber es ist schwierig, eine Platte aufzunehmen, die anders klingt, wenn man auf die üblichen Instrumente zurückgreift.“
Wie zu dieser Zeit noch ein Musiknerd am Werk ist, zeigt das Stück „I’m Yours“, ein deftiger Jam zwischen Hardrock und Funk, mehr Laborarbeit als Pophit – und vom Arrangement her nicht weit entfernt von vielem, was später in den 1990ern unter dem Namen Crossover die Hosen ins Rutschen bringen sollte. Nur, dass diese Musik bis auf wenige Ausnahmen nicht so guten Gitarristen gespielt wurde.