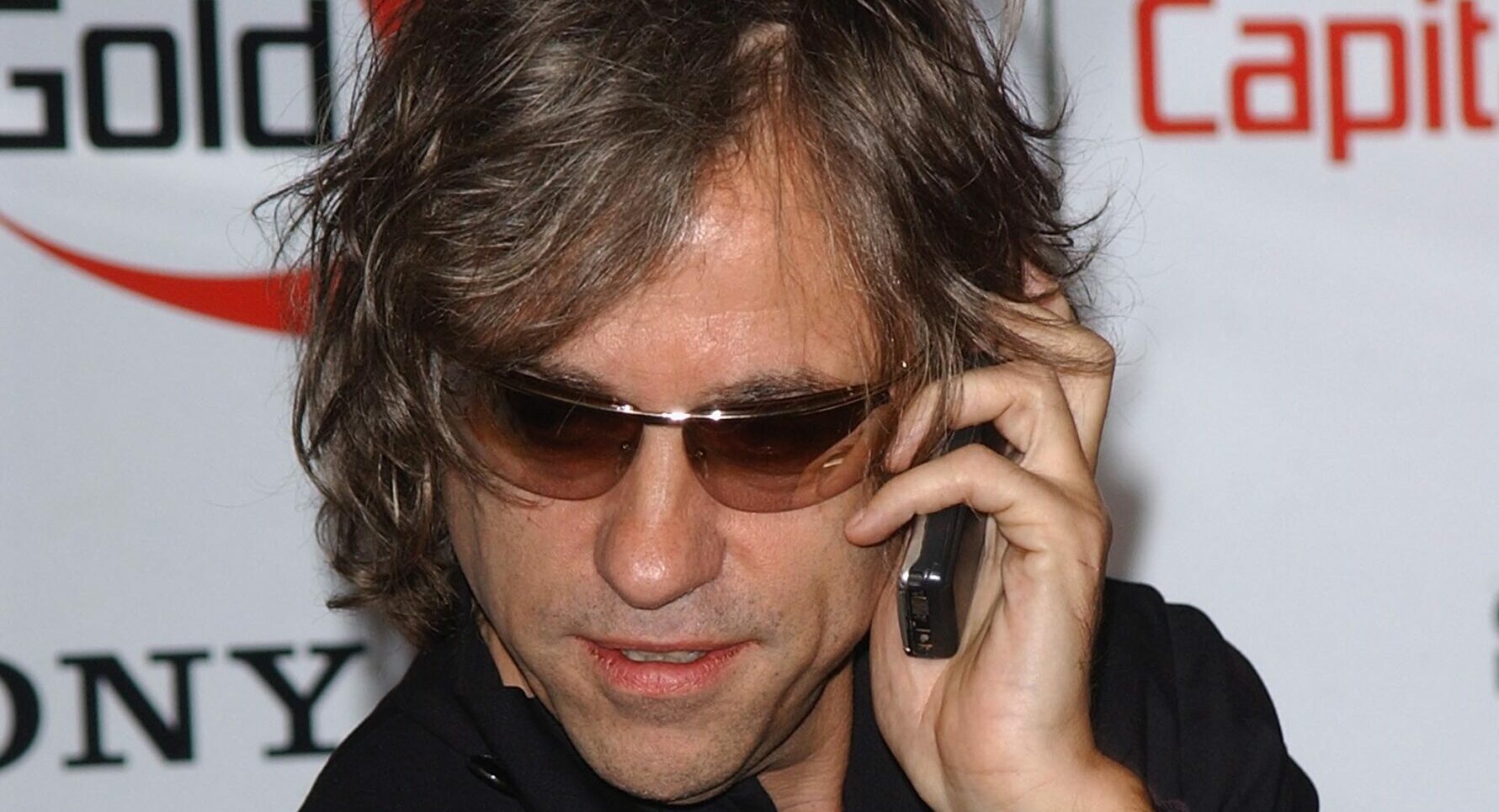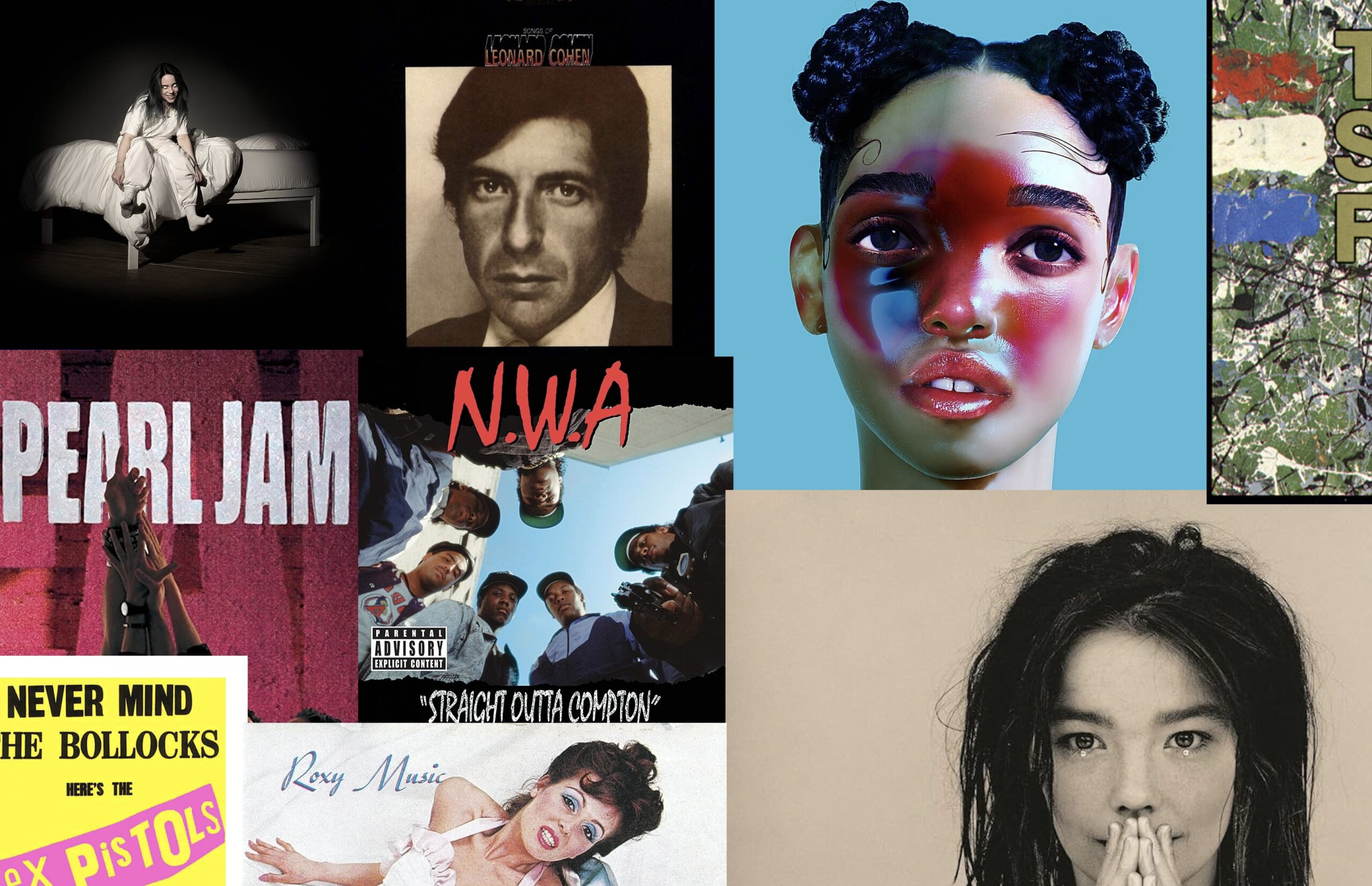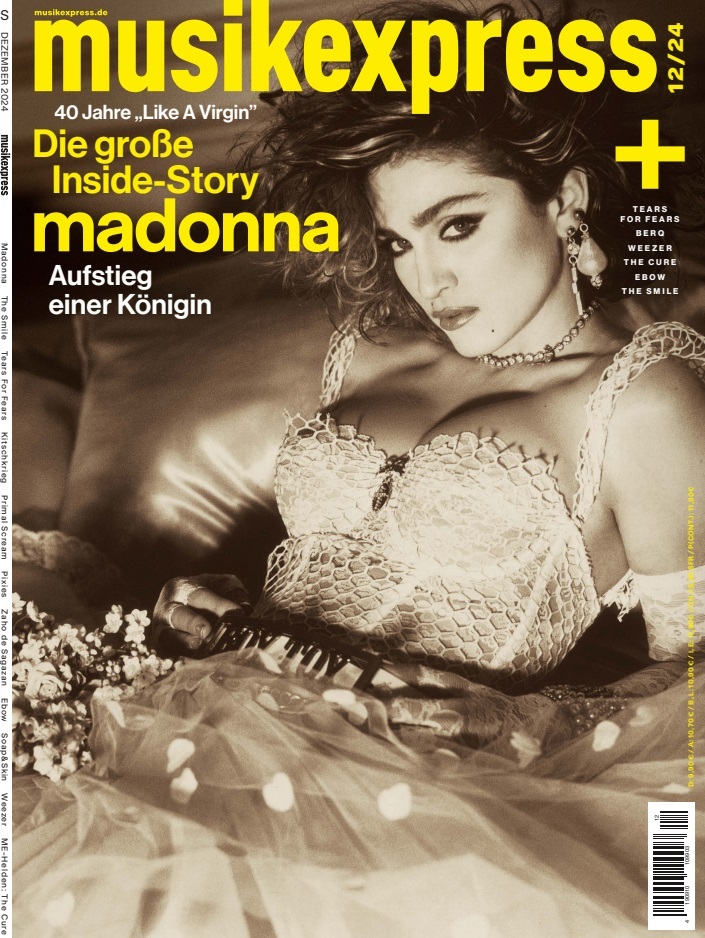Amy Winehouse – Sie musste singen
Was leicht vergessen wird: Amy Winehouse war Musikerin durch und durch, es gab keine Trennung zwischen ihrem Leben und ihrer Kunst. Albert Koch würdigt ihr Werk.
Amy Winehouse liegt mit geschlossenen Augen und ausgestreckten Armen auf dem Boden. Im Kopf ein Einschussloch, die Ausläufer der schwarzen Turbanhaare umranden eine Blutlache. Die Plastik des italienischen Künstlers Marco Perego spielt auf den amerikanischen Beatpoeten William S. Burroughs an. Der hatte Anfang der Fünfziger Jahre seine Ehefrau Joan Vollmer versehentlich erschossen, als er volltrunken mit ihr die Apfelszene aus Schillers „Wilhelm Tell“ nachstellen wollte. Das Kunstwerk trägt den Titel „The Only Good Rock Star Is A Dead Rock Star“. Vor dem Hintergrund des Todes von Amy Winehouse am 23. Juli wirkt die Plastik noch eine Spur makabrer, allerdings wird die Behauptung, die ihr Titel aufstellt, in den nächsten Wochen von der Realität bestätigt werden. Dann werden wir wieder einmal sehen, dass tote Rockstars vor allem für die Musikindustrie die besten Rockstars sind, wenn die Platten aus dem nicht sehr umfangreichen Backkatalog von Amy Winehouse wieder in die Charts kommen. Wahrscheinlich wird zurzeit schon fieberhaft daran gearbeitet, aus unveröffentlichten Aufnahmen und Demos ein drittes Studioalbum zu kompilieren, das rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in die Läden gestellt wird. „Wahrscheinlich hätte Amy es so gewollt“, wird die zuständige Plattenfirma dann verkünden müssen.
Amy Winehouse war eine Sängerin für den Mainstream. Ihr kommerzieller Erfolg – allein vom zweiten und letzten zu Lebzeiten veröffentlichten Album Back To Black – wurden weltweit mehr als elf Millionen Exemplare verkauft – kann nicht allein mit einer plötzlichen Besinnung der Massen auf den guten Geschmack erklärt werden. Freilich hat das skandalträchtige Gossip-Girl Winehouse seinen Beitrag dazu geleistet, damit sich die Platten der Musikerin Winehouse verkauft haben. Was aber letztlich einer gewissen Logik folgt: Es gab keine Trennung zwischen ihrer Musik und ihrem Leben, wieso sollte ihr Leben nicht ihre Musik verkaufen? Amy Winehouse war Musikerin durch und durch, sie musste singen, sie konnte nicht anders. Ihre Weigerung, sich mit aktueller Musik zu beschäftigen, entsprang einer inneren Überzeugung und nicht dem Wunsch nach popkulturellem Dissidententum. Wie zur Bestätigung coverte sie auf der semi-offiziellen The Ska EP Jahrzehnte alte Songs von Toots & The Maytals, The Specials, The Skatalites und Sam Cooke.
Amy Winehouse war gerade 20 Jahre alt geworden, als ihr erstes Album Frank im Herbst 2003 veröffentlicht wurde. Dieses Debüt hatte den „modernen R’n’B“ nicht neu erfunden, das Album unterschied sich allerdings teilweise dramatisch von den üblichen zeitgenössischen Produktionen. Es war ein Amalgam aus Funk und Soul und Dub-Reggae und vor allem Jazz – in Liedern wie „Moody’s Mood For Love“, „Help Yourself“ und „(There Is) No Greater Love“ war ihre Vorliebe für Sängerinnen wie Ella Fitzgerald, Dinah Washington und Nina Simone deutlich herauszuhören. Die Kratzigkeit ihrer Stimme wurde immer wieder mit der von Macy Gray verglichen.
Es bedurfte der Intervention von Produzent Mark Ronson, um die künstlerische Kraft der Winehouse zu kanalisieren. Ronson baute die Songs auf dem zweiten Album Back To Black – das augenzwinkerte, biografische „Rehab“, „Love Is A Losing Game“, „Back To Black“ – um das größte Kapital der Londonerin herum: ihre Stimme. Back To Black markierte die Verwandlung von Winehouse von einer Künstlerin, die auf ihrem ersten Album noch allen „schwarzen“ Musiken zugetan schien, zu einer reinen Soul-Vokalistin. Diese Musik stand in der Tradition von Motown und dem klassischem Soul der Sechziger und Siebziger. Winehouse ging zurück in der Geschichte der schwarzen Musik: Back To Black. In „Tears Dry On Their Own“ etwa wird „Ain’t No Mountain High Enough“, der 1967er Hit von Marvin Gaye und Tammi Terrell, gesampelt. Der Retro-Soul des Albums war nicht zwangsläufig als Unterhaltung für Oberstudienräte gedacht, die sich an ihre Kindheit erinnern wollten; er kam so selbstverständlich, so natürlich rüber, als sei Winehouse mal eben mit einer Zeitmaschine aus der Vergangenheit eingeflogen. Was geholfen hat, das Album zu einem kleinen Meisterwerk der mittleren Nuller Jahre zu machen, war eine kluge Entscheidung Ronsons: er heuerte als Backing-Band die Soul-erfahrenen Dap Kings aus Brooklyn an, die normalerweise die amerikanische Sängerin Sharon Jones begleiten, die wiederum im Schatten des Erfolges von Back To Black mit ihrem 2007er-Album 100 Days, 100 Nights ein kleines Comeback feierte. Zeitnahe Coverversionen sind immer ein Indiz für die popkulturelle Relevanz der Originalinterpreten. Die Songs von Back To Black wurden u.a. von Hot Hot Heat („Rehab“), Elbow („Back To Black“) Prince („Love Is A Losing Game“) und Wanda Jackson („You Know I’m No Good“) gespielt; Josh Homme baute den Text von „Rehab“ bei Konzerten von Queens Of The Stone Age in seinen Song „Feel Good Hit Of The Summer“ ein.
Das Schöne an den modischen Launen der Popkultur – sie sind nicht vorhersehbar. Niemand hat prophezeien können, dass der Pop-Herbst 2006 dringend ein Retro-Soul-Album wie Back To Black benötigen würde. Der Sixties-Soul als Bezugspunkt zieht sich seit Jahrzehnten immer wieder durch die diversen Nischen der Popmusik. Back To Black allerdings war der Ausgangspunkt eines Soul-Revivals im Mainstream. Offensichtlich gab es einen Bedarf an dieser Musik, den Winehouse alleine nicht decken konnte. Der Erfolg von Musikerinnen wie Adele und Duffy basiert auf dem von Amy Winehouse. Selbst Lady Gaga betonte einmal, dass Winehouse ihr den Weg geebnet habe – beide sind Stars in einem Mainstream geworden, ohne die Klischees des Mainstream zu bedienen.