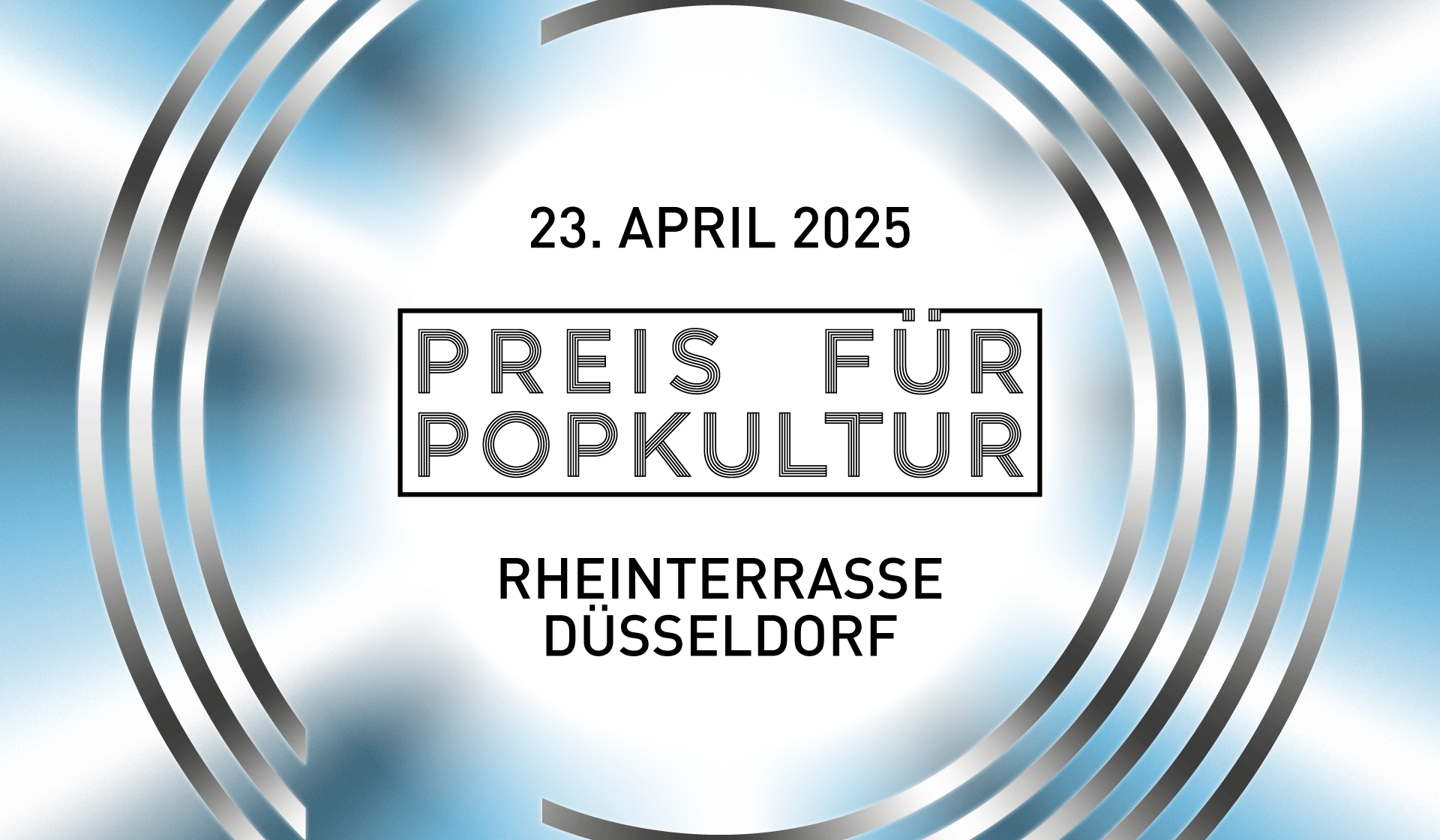Preis für Popkultur 2018: 5 Dinge, über die wir noch reden müssen
Zum dritten Mal verlieh der Verein zur Förderung der Popkultur seinen Preis, der nie wie der Echo werden sollte. Sollte.

Der Preis für Popkultur will so anders sein, so viel anders machen. Das fällt bereits daran auf, dass der stiftende Verein zur Förderung der Popkultur nicht etwa – wie so viele andere Awards – im Frühjahr, sondern im Herbst zur Preisverleihung lädt. Man ist hier ja unter alternativen, unabhängigen Köpfen, da hält man sich natürlich nicht mit tradierten Strukturen der Unterhaltungsbranche auf.
Wenn Basisdemokratie gut gemeint ist – und anscheinend nicht funktioniert
Der Preis für Popkultur rühmt sich damit, dass er basisdemokratisch von den (zahlenden) Mitgliedern des stiftenden Verein zur Förderung der Popkultur gewählt wird. Der hat bereits um die 800 Mitglieder, die aus der Musik- und Medienbranche stammen – und anscheinend etwas wahlfaul sind. Das kreidet zumindest Vereinsvorsitzende Anne Haffmans bei der Begrüßung im Foyer des Tempodroms an. Zwar hätten die Mitglieder über 500 Nominierungen eingereicht, die Teilnehmerzahl in den beiden Abstimmungsphasen sei jedoch weit unter den Erwartungen geblieben. Und jeder, der etwas Mathekenntnisse hat, weiß, was für enorme Auswirkungen das auf eine Wahl haben kann: Je geringer die Zahl an abgegebenen Stimmen ist, desto höhere Ergebnisse können bereits kleine Gruppen aus der absoluten Anzahl der Wahlberechtigten erwirken. Ergo: Stimmt etwa das gesamte Management Trettmanns geschlossen für ihren Schützling als „Lieblingskünstler“, kann es ihnen herzlich egal sein, wenn sonst niemand abgestimmt hat.
Jeder spricht von Gleichberechtigung – doch keiner macht was dafür
Wieder geht Anne Haffmans bereits vor der eigentlichen Preisverleihung in die Offensive: Die Kritik an der Nominiertenliste der bisherigen und diesjährigen Verleihung des Preises für Popkultur sei angebracht. Auch 2018 waren in 10 geschlechtsneutralen Kategorien gerade einmal drei Künstlerinnen und zwei Journalistinnen nominiert – viel zu wenige bei ingesamt 50 Nominierten in den Kategorien. Der stiftende Verein versuche die Geschlechtergleichberechtigung zu leben, bereits 35 Prozent der Mitglieder seien weiblich, im Vorstand seien sogar mehr Frauen als Männer vertreten, verteidigt sich der Veranstalter. Doch verwalterische Gleichberechtigung ändert nichts daran, dass die deutsche Poplandschaft weiterhin eine „Würstchenparade“ ist, wie es der ehemalige Intro-Chefredakteur Daniel Koch später auf der Bühne ausdrückt. Trotz aller ehrenhaften Worte und Bemühungen des Vereins zur Förderung der Popkultur liegt offensichtlich ein strukturelles Problem in der deutschen Popmusik vor. Anders lässt es sich nicht erklären, dass kein einziger geschlechtsunabhängiger Preis an eine Künstlerin verliehen wurde.
Humor ist offenbar, wenn man das doch wohl noch sagen darf
Pop und Popkultur sind von Haus aus jugendliche und junggebliebene Angelegenheiten. Umso unangenehmer, wenn Menschen, die wahrscheinlich noch das Wort „poppig“ nutzen, jung bleiben wollen, um ihren Platz in der Popwelt nicht abgeben zu müssen. So wie etwa Tommy Wosch. Der als „Radiolegende“ angekündigte Co-Moderator setzt mehr Pointen daneben als die deutsche Fußballnationalmannschaft Schüsse derzeit. Egal ob er sein Outfit aus bauchfreiem Alba-Berlin-Shirt und ausgebeultem Sakko damit zu erklären versucht, dass er nicht dasselbe wie Rapperin Haiyti tragen wollte, oder zum xten Mal Casper anspricht, wie er sich denn fühle, jetzt, wo ein weiterer Preis nicht an ihn gegangen ist: Wosch ist latent bemüht, locker und lässig zu wirken und lässt damit nicht nur seine Co-Moderatorin Claudia Kamieth das ein oder andere Mal die Stirn runzeln. Lowlight seines Auftritts: Nachdem Birgit und Horst Lohmeyer für ihr „Jamel rockt den Förster“-Festival und den Einsatz gegen rechts ausgezeichnet wurden, kommt Wosch zurück auf die Bühne und versucht es mit einem Spruch, der wohl als sarkastische Spitze angedacht war: „Puh, das waren aber einige harte Minuten für mich als Neonazi erster Stunde.“ Lustig ist das wahrlich nicht.
Ebenso unlustig der spätere Auftritt eines bekannten Journalisten, der nach dem Ende der Gala das Publikum zum Befüllen der Nebenbühne, auf der Gurr auftreten sollen, animiert, indem er die Anwesenden als „Fotzen“ beschimpft. Aber gut, da lagen bereits vier Stunden Freisuff hinter allen Beteiligten.
Die Nominierten kommen uns bekannt vor – ist Deutschlands Musikbranche so eindimensional?
Über 500 Nominierungen seien für den Preis für Popkultur 2018 eingegangen, hatten die Veranstalter zu Beginn verlauten lassen. Eine ganze Menge, denkt man sich. Wie kann es dann sein, dass Haiyti nach 2017 erneut als Lieblingskünstlerin nominiert ist? (Gleiches gilt übrigens auch für Casper bei den Männern.) Gehen die Leute nur zu Casper-, Beatsteaks- und K.I.Z.-Konzerten – oder warum sind ihre Live-Shows einmal mehr als „beeindruckendste“ nominiert? Hat dieses Land nicht mehr Produzenten als Moses Schneider, Tobias Kuhn und Markus Ganter zu bieten, die für ihre Arbeit nominiert zu werden verdient hätten? Fragen über Fragen, auf die der PFP keine Antworten liefert, da alle seine Entscheidungen mit den basisdemokratischen Prozessen des stiftenden Vereins erklärt werden. Natürlich kann es da passieren, dass solche Nominiertenlisten entstehen, wenn eben eine Menge Mitglieder dem Casper- oder Beatsteaks-Dunstkreis angehören. Den Vorwurf des Industrieinzest, der ewig bleiern über dem Echo lag, muss sich der PFP so jedoch auch gefallen lassen.
Die Gewinner gehen in Ordnung
Dass der Preis für Popkultur – trotz aller Probleme – dann eben doch eine recht gute Sache ist, sieht man an den Gewinnern: Dancehall- und HipHop-Veteran Trettmann wurde für seine Neuausrichtung als nachdenklicher Traplord nicht nur als Lieblingskünstler ausgezeichnet, sein minimalistisches Graustufenalbum #DIY wurde – mit einer grandiosen Laudatio von Klaus Fiehe – zum Lieblingsalbum, sein Plattenbautenerinnerungssong „Grauer Beton“ zum Lieblingslied gekürt.
Auch mit dem Preis für „Gelebte Popkultur“ an Birgit und Horst Lohmeyer für ihr Festival im von Rechtsradikalen durchsetzten Jamel (Mecklenburg-Vorpommern), machte die Jury alles richtig. Überraschend – und gerade deshalb so schön – die Auszeichnung an Sam Vance-Law als „Hoffnungsvollsten Newcomer“, der sich mit seinem musikalischen Tagebuch des queeren Lebens gegen die mit Revolverheld gemeinsame Sache machende Antje Schomaker und gegen die beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung auftretenden SIND durchsetzte.
Gerade der letzte Punkt gibt einem Mut, dass der Preis für Popkultur noch zu dem werden könnte, was man sich wünscht und was er auch von sich selbst erwartet: ein unabhängiger und anerkannter Preis, der das künstlerische Werk von Musikern und Kulturschaffenden würdigt. Bleiben die Verantwortlichen weiter so selbstreflexiv und -kritisch, wie es die Vorsitzende Anne Haffmans ist, könnte man diesem Ziel bereits im nächsten Jahr ein gutes Stück näher kommen.
[facebooklikebox titletext=’Folgt uns auf Facebook!‘]