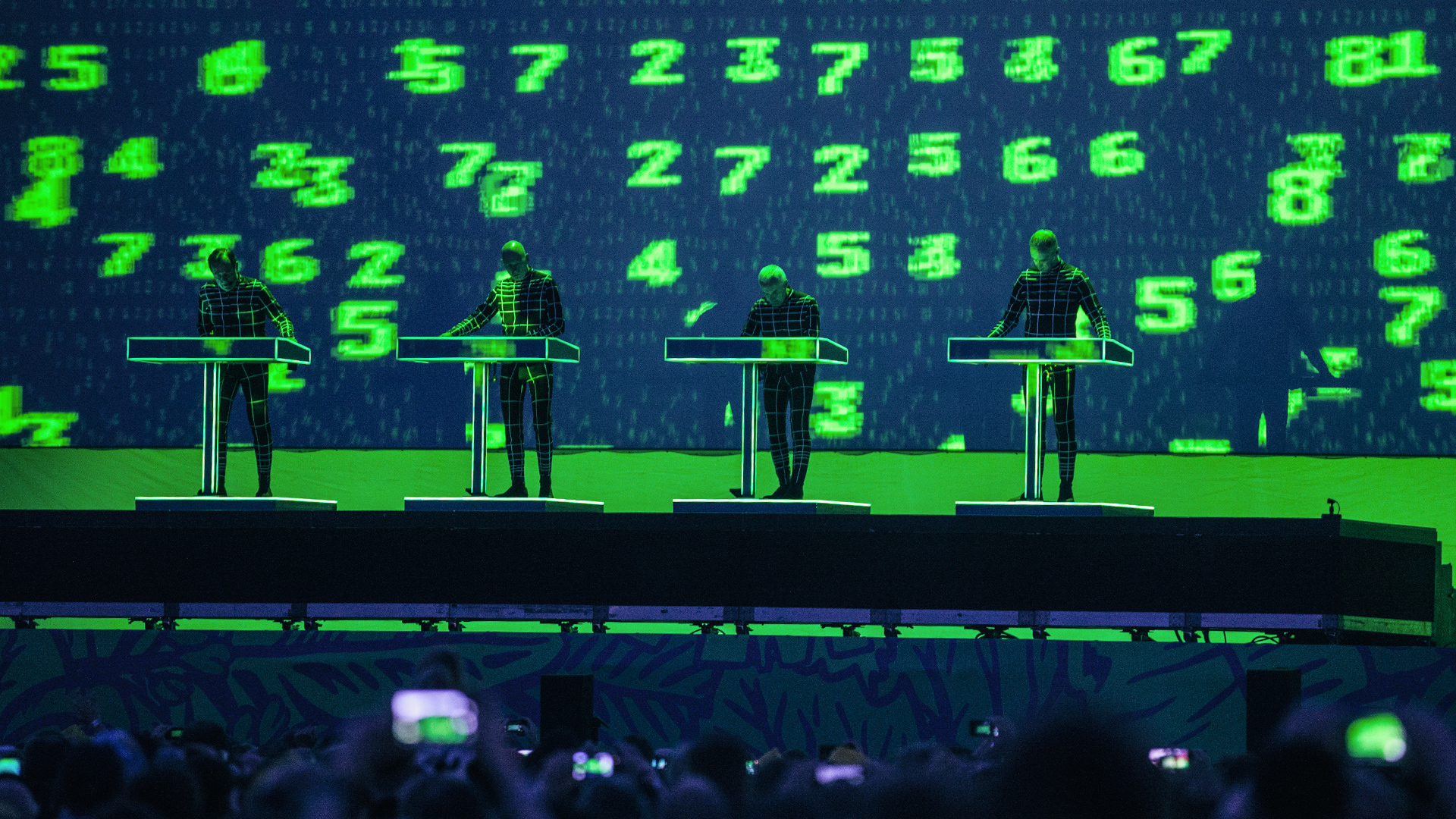Frank Ocean

Er hat keine Hitsingle, nur eine Handvoll meist weniger gelungener Shows gespielt und vermutlich noch nicht einmal Obamas Telefonnummer. Dennoch ist Frank Ocean der Mann des Jahres 2012. Weil er das wichtigste R&B-Album seit Langem aufgenommen hat. Und weil er mehr als jeder andere Popstar die Frage aufwirft, was das eigentlich ist: ein Popstar.
„4 summers ago, I met somebody. I was 19 years old. He was too. We spent that summer, and the summer after, together. Everyday almost. And on the days we were together, time would glide.“
Und was hast du so in den Ferien gemacht? Man könnte mit einigem Recht einwenden, dass es Wichtigeres gibt als die amourösen Abenteuer eines sensiblen Teenagers in Kalifornien, in Briefform ausgebreitet auf Tumblr. Aber andererseits: Gibt es Wichtigeres als die Liebe, als die Kraft klarer, schöner, unprätentiöser Worte? Denn es standen eben auch andere Dinge in dieser Post-Sendung vom 4. Juli 2012, die der Welt zwar nicht mehr Freiheit brachte, aber zumindest eine wundervolle Ahnung davon. „Whoever you are. Wherever you are … I’m starting to think we’re a lot alike. Human beings spinning on blackness. All wanting to be seen, touched, heard, paid attention to.“ Nun begibt es sich zufällig, dass der Autor dieser Zeilen ein amerikanischer R&B-Sänger ist und er eben von einem Mann gesehen, berührt, gehört, beachtet werden wollte, was selbstredend sehr schnell dafür sorgte, dass sich keiner mehr um prosaische Finessen scherte, sondern lediglich noch um Schlagzeilen. „Frank Ocean“, Doppelpunkt, „schwul“, Ausrufezeichen. So funktioniert das Internet, so funktioniert der Mensch.
Die einen sahen darin einen bemerkenswerten Akt sexueller Selbstbestimmung, einen Befreiungsschlag revolutionären Ausmaßes. Die anderen den Amazon-Vorbestellungslink für das nur eine Woche später erscheinende Album Channel Orange und argwöhnten, dass es hier um schnöde Promo-Belange gehe. Auch so funktioniert eben das Internet. Und dennoch gibt es zwischen diesen Zeilen mehr zu lesen als eine Sensationsmeldung oder die Enttäuschung darüber, dass eine so normale Sache 2012 noch eine Sensationsmeldung sein kann. Dass es eben nie zu spät ist, etwas auszusprechen, nur weil es schon vor Jahren hätte ausgesprochen werden sollen, zum Beispiel. Oder dass gute Musik gute Musik bleibt, auch wenn sie aus den falschen Gründen gehört wird.
Channel Orange ist mit Sicherheit das wichtigste und wohl beste R&B-Album im Jahr eins nach der großen Alt-Soul-Explosion um Ocean, The Weeknd, SBTRKT, Jamie Woon und Co. Es ist kein Meisterwerk, so wie Frank Ocean kein Spitzensänger im leistungssportlichen Sinn ist, kein Oktavenakrobat, an dem sich samstagabends ein verirrtes Glotzvolk auf der Suche nach „echten“ Talenten ergötzen könnte. Nicht alle Beats sitzen, nicht alle Arrangements halten ihrem Anspruch stand, Oceans Wortwahl schlägt immer mal wieder ins Banale um.
Aber in seiner Gesamtheit ist das Album der konsequenteste Ausdruck einer vielschichtigen künstlerischen Vision, die durchaus stellvertretend steht für eine Generation von Musikern, denen Genres tatsächlich nichts bedeuten: ausschweifend, atmosphärisch, ambitioniert, ambivalent und auf sehr selbstverständliche Weise eigenständig. Da ist Pink Floyd, aber da ist auch Prince. Da ist Stevie, aber da ist auch Steve Jobs. Da ist Gestern, Morgen und vor allem ganz viel Heute. Das Heute von Christopher Breaux, geboren 1987 in Long Beach, California, dort, wo das Meer ist, die Sonne, die Party, die Mädels, die Jungs und die immer wiederkehrenden Zweifel, ob es der ganze Scheiß überhaupt wert ist. Noch mal zur Erinnerung: Wir sprechen hier von R&B. Dieser trendgeilen, in seiner Essenz aber seit Jahren erstaunlich starren Königsdisziplin des Kunstkommerzes, in der Männer mehr noch als irgendwo sonst klaren Rollenvorgaben zu entsprechen haben. Hier der gebrochene Genius à la Marvin Gaye und D’Angelo; dort der virile Vortänzer vom Schlage Ushers. Für eine gewöhnliche menschliche Existenz ist dazwischen leider kein Platz. Weil er genau diese aber zum Thema seiner Musik macht, hat Ocean seinem Genre zurückgegeben, was es zuletzt in den späten Neunzigern hatte: Konsenspotenzial.
Alle lieben Frank Ocean. Kollegen wie Beyoncé und Alicia Keys, die sich im Studio nach seinem Stift und seiner Stimme verzehren. Die Hipster in Brooklyn und Berlin-Neukölln, die sich in seinen feinsinnigen Texten zwischen Hedonismus und Heimkommweh wiederfinden. Die Traditionalisten, die bei Channel Orange Reminiszenzen an Sly and The Family Stone und die Minnesota-Ära raushören. Die Journalisten, die seine post-post-moderne Deutung des Soul-Begriffs vielspaltig abfeiern. Und natürlich die R&B-Jungs, die immer da sind, wo die R&B-Mädels sind, also bei Frank Ocean, obwohl der vermutlich gar nichts wissen will von den R&B-Mädels. Denn Frank Ocean ist nicht „for the ladies“. Frank Ocean ist für alle da. Glauben zumindest immer alle.
Frank Ocean war dazu verdammt, vereinnahmt zu werden. Von Aktivisten und Artists, echten Fans und falschen Freunden. Aber er hat sich nicht vereinnahmen lassen. Seit dem im wahrsten Sinne des Wortes überwältigenden Erfolg von Channel Orange ist er fast komplett abgetaucht. Abgesagte Konzerte (u. a. im Vorprogramm von Coldplay) und gar nicht erst zugesagte Interviews gehören längst zu seiner Persona wie das jungenhafte Auftreten und die oft kryptischen Wort- und Bildmeldungen auf Twitter oder Tumblr.
Es wird ihm oft als Arroganz ausgelegt oder leichtfertig als die branchenübliche Unzuverlässigkeit abgetan. Nase oben, heißt es hier. Nase voll, heißt es dort. Dass da ein sensibler Mittzwanziger gerade rechtzeitig den Pausenknopf gedrückt hat, zieht kaum jemand in Erwägung. Als wäre es das Absurdeste auf der Welt, mal ein paar Wochen nicht überall zu sein. Frank Ocean ist ein Kind der digitalen Revolution. Aber das heißt noch lange nicht, dass er sich deswegen von ihr auffressen lassen will.
Kürzlich war er mit Jay-Z und Pharrell im Studio. Er war beeindruckt von der warmherzigen Vertrautheit der beiden Megastars und Multimillionäre, ihrer Energie und ihrem Tatendrang. „I wonder why they still build“, schrieb er auf Tumblr. Und zog daraus seine eigenen Konsequenzen: „I build things for the sport and the therapeutic benefits.“ Nicht unbedingt die Gedanken, die einem typischen R&B-Star auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere durch den Kopf gehen. Aber Channel Orange ist eben auch kein typisches R&B-Album, schon insofern, als es ein Album ist und mehr als nur die virtuelle Kartonage für einen Hit, die nur nötig geworden ist, weil keiner mehr zehn Euro für eine Maxi-CD ausgeben mag.
Wie lange haben wir eigentlich schon nicht mehr richtig zugehört, innegehalten, nachgedacht, fragte der Kritiker Sasha Frere-Jones in seiner Rezension für den New Yorker. Verdammt lange nicht mehr. Aber: „Whatever Ocean is paying attention to, we are paying attention to.“ Das – und der Mut, als alles gesagt war, nicht einfach weiter zu plappern, machen ihn zum Mann des Popjahres.