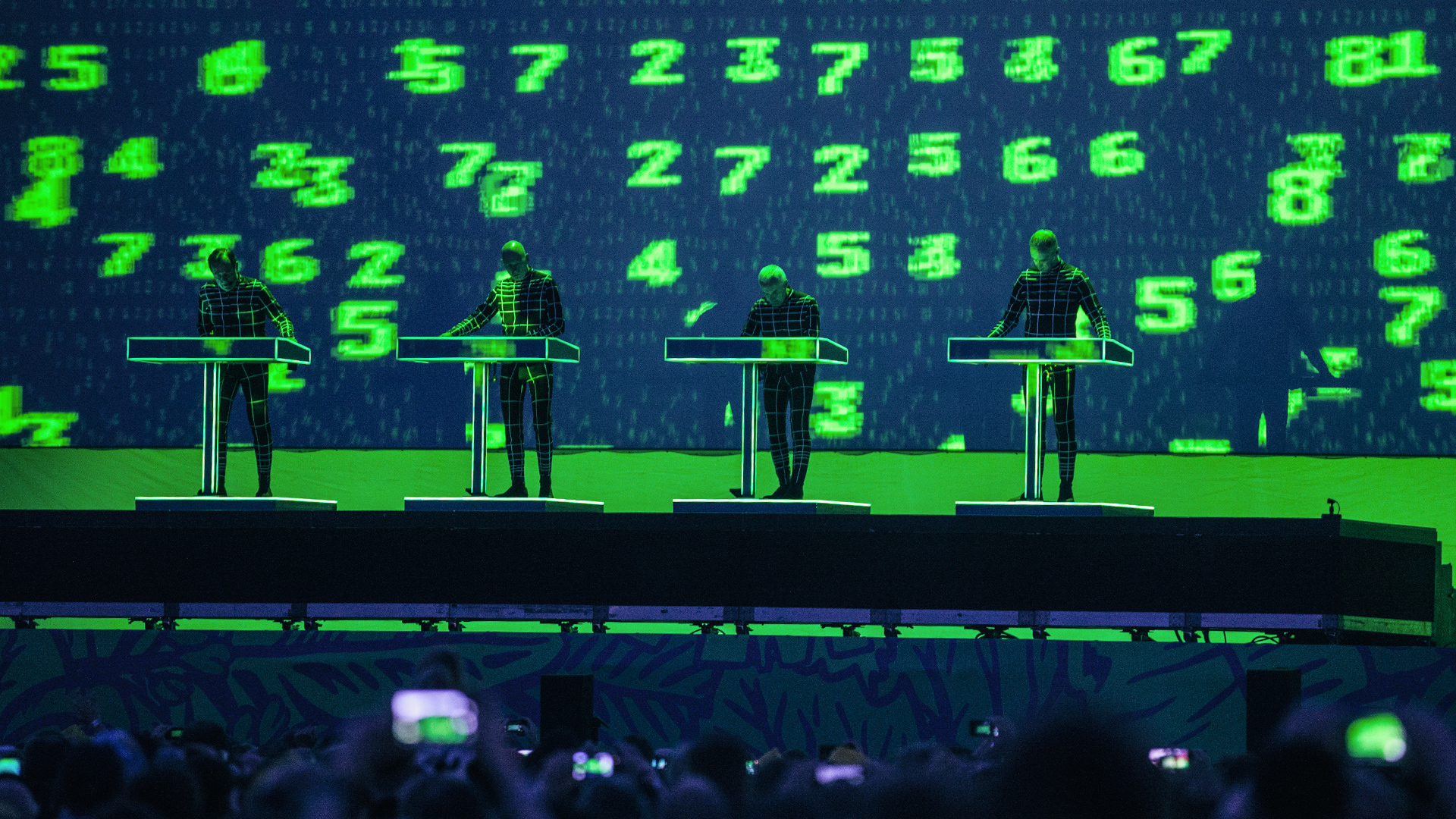Die 25 besten Debütalben aller Zeiten
Von den Beatles bis Velvet Underground: Das hier sind die von der Musikexpress-Redaktion und ihren Autor*innen gewählten Top 25 der 100 besten Debütalben aller Zeiten.

Listen, Listen, Listen! In der Musikexpress-Ausgabe 9/2021 kürten wir demokratisch die 100 besten Debütalben aller (bisherigen) Zeiten. Seinen diese Liste begleitenden Text mit der Überschrift „Once In A Lifetime“ leitete ME-Autor André Boße mit der Zusammenfassung ein: Ein Debüt besitzt keine Vergangenheit und kümmert sich nicht um die Zukunft. Ein Debüt ist Gegenwart, und es verwundert daher nicht, dass die besten Werke der Gegenwartskultur Popmusik erste Alben sind. Eine Annäherung an das Phänomen Debütalbum.“ Diesen Text sowie die Plätze 100-26, darunter die Debütalben von zum Beispiel Rage Against The Machine, Pixies, Lady Gaga, Hot Chip, Sophie, The Cure, Suede, Pearl Jam, PJ Harvey, Blumfeld, Cindy Lauper und Elvis Presley, findet Ihr in besagtem Heft, das Ihr hier nachbestellen könnt. Die Plätze 25-1, Vorhang auf, die präsentieren wir Euch hier und jetzt!

Die Top 25 der 100 besten Debütalben aller Zeiten
25. The Beatles – PLEASE PLEASE (1963)
Mit „Love Me Do“ und „Please Please Me“ als Vorboten, trat das in einer 12-stündigen Marathonsession unter Ägide von George Martin entstandene Debüt eine globale Lawine los, die erst durch Paul McCartneys Rückzug im April 1970 Halt fand. 14 energische Stücke von knapp 33 Minuten – acht Songs von Lennon/McCartney, sechs US-Cover. Sämtliche Mitglieder sangen mal Leadstimme. Rasch transformierte sich das Genre Merseybeat zu Beat, versuchten weltweit zahllose Jugendliche das Erfolgskonzept zu kopieren, was den Band-Boom förderte. Als erster Höhepunkt eroberte die von den Beatles angeführte British Beat Invasion den Europäern bis dahin weitgehend verschlossen gebliebenen US-Markt. (Mike Köhler)
Was danach geschah: Nicht nur, dass die Beatles die selbstbestimmte Band erfanden sowie zig Trends setzten. Bis heute gelten die Fab Four als Nonplusultra.
24. Patti Smith – HORSES (1975)
Das Debüt, und ihr definitives Album. Der erste Satz, dass Jesus für die Sünden von irgendjemand anders gestorben ist, aber nicht für ihre, ist genauso Ikone wie das androgyne Coverfoto. Ihr Freund Robert Mapplethorpe hat es geschossen. „Words are just rules and regulations to me“, ätzt Smith im Song „Gloria“, entsprechend frei geht sie mit ihnen um. Eindeutig ist das wenigste. Johanna von Orléans kommt vor, Blake und Rimbaud. Es geht, so viel ist klar, um Eroberung, Tod, Sex, Drogen, (kein) Geld. Um Liebe freilich auch. Dazwischen Versatzstücke von alten Popsongs. HORSES ist klassischer New-York-Sound, Punk, surreale Poesie, Avantgarde und „simple Rock’n’Roll“. (David Numberger)
Was danach geschah: Als Dichterin hat sie angefangen, heute schreibt Patti Smith mystisch-magische Erinnerungsbücher.
23. Ramones – RAMONES (1976)
Im New Yorker CBGB’s zunächst noch belächelt, war spätestens am 23. April 1976 klar, dass die dysfunktionale Familie Ramone es absolut ernst meint. Allein der Blick auf die Tracklist erscheint aus heutiger Sicht, als würde man ins klingende Geschichtsbuch horchen: Die Geschichten vom Blitzkrieg und vom Baseball-Schläger, all die Dinge, die man will (Klebstoff schnüffeln) und nicht will (mit der Liebsten herumlatschen), die Sache mit Judy, die Havanna-Affäre, das Leben zwischen Basement und Straßenecke, vertont im Scheitelpunkt aus Melodie und Tempo – alles so over the top, gleichzeitig perfekt, ist dies eine der historisch hochverdichtetsten 29 Minuten of all things Punkrock, monochromatisch und majestätisch. (Ingo Scheel)
Was danach geschah: One-Two-Three-Four Welteroberung, zu Lebzeiten und posthum.
22. Arcade Fire – FUNERAL (2004)
Der Missing Link zwischen Marching Bands, Orchestergräben und Indie-Rock: Als Arcade Fire 2004 um die Eheleute Win Butler und Régine Chassagne aus Montreal die Welt eroberten, taten sie das buchstäblich mit Pauken und Trompeten, mit Akkordeons, Xylophonen, Orgeln, Celli, Harfen, Handclaps, Synthesizern – und einem bisweilen euphorisch klingenden Konzeptalbum über den Tod, das fast alle großen Musikmagazine zu einer der besten Platten der 2000er kürten. „Wake Up“ und „Rebellion Lies“ zählen auch live zu ihren bis heute eingängigsten Hits. (Fabian Soethof)
Was danach geschah: Ein Konzeptalbum über Vorstädte, ein Soundtrack für Spike Jonze, eine Hommage an Disco und David Bowie, eine schlagereske Platte mit Panflöten: Stillstand kann man Arcade Fire nicht vorwerfen. Mainstreamanschluss aber auch nicht.
21. Pink Floyd – THE PIPER AT THE GATES OF DAWN (1967)
Kaum ein Album der drogenseligen Sechziger bringt die Ambivalenz jener Jahre so drastisch auf den Punkt. Einerseits: LSD-inspirierte, surreale und märchenhaft verschrobene Kleinode, die in Komposition und Darbietung schlicht unvergleichlich ausfielen. Andererseits: Protagonist Syd Barrett, der die Band bereits Anfang 1968 verlassen musste und – zumindest zeitweise – ein Fall für die Psychiatrie wurde. Ein dezidiert britisches, erfreulich exzentrisches Meisterwerk des frühen Psychedelic-Rock, das mit Pink Floyds deutlich kommerziellerem Breitwand-Sound späterer Jahre rein gar nichts zu tun hat. (Uwe Schleifenbaum)
Was danach geschah: Barrett veröffentlichte zwei eigenartige Soloalben, die völlig zu Recht unter Kultverdacht stehen. Pink Floyd wurden Superstars – auch ohne ihren „crazy diamond“.
20. Tom Waits – CLOSING TIME (1976)
Gerade mal 22 ist Tom Waits bei den Aufnahmen zu seinem Debüt, als er mit seinem Produzenten Jerry Yester (von Lovin’ Spoonful) aneinandergerät: Waits schwebte ein von Klavier und Kontrabass getriebenes Jazz-Album vor. Yester dachte eher an ein gitarriges Folk-Album. Vielleicht war Waits daran nicht ganz unschuldig – schließlich bestand ein nicht zu geringer Teil seiner Live-Sets damals noch aus Bob-Dylan-Coverversionen. Heraus kommt also ein Folk-Jazz-Hybrid. Aber was für einer! (Stefan Hochgesand)
Was danach geschah: Auf dem Debüt klingt die Waits-Stimme noch vergleichsweise unverschlissen. Nach unzähligen „Old Gold“-Zigaretten und Whiskey-Gläsern hat sich Waits zwei, drei Jahre später die Stimme auf ein Level ruiniert, das zu seinem Markenzeichen wurde – und auch die Arrangements wurden viel rumpeliger.
19. Wanda – AMORE (2014)
Die Idee war gut, und die Welt so was von bereit: Die Österreicher retteten 2014 im Alleingang den Rock’n’Roll mit dem, was man ein Gesamtpaket nennt: Gute Typen spielten gute Songs. Wobei: Wanda fügten an allen Ecken und Enden etwas hinzu. Die Wiener weckten Verlangen, indem sie dem Debüt drei hervorragende Singles vorausschickten (das erinnerte an Oasis). Sie formulierten einen eigenen Claim, der sofort im Kopf blieb („Amore!“). Und sie streuten einen Zauberstaub über ihre Songs, der streng nach altem Schnaps roch, nach der Luft des empfehlenswerten Wiener Lokals „Kreisky“ und den Achselhöhlen von Mick Jagger, ca. 1972. (Jochen Overbeck)
Was danach geschah: Die Wiener mach(t)en weiter, immer weiter. Und „Amore“ ist vier Alben später zum Schlachtruf auch jenseits von Wanda geworden. Gerüchten zufolge soll nach NIENTE von 2019 bald ein neues Album erscheinen.
18. The Strokes – IS THIS IT (2001)
Ja genau das ist es – ein absolut geradliniges wie simples Rockalbum. Eines, das schon vorab so einen Hype erfuhr, dass man weit mehr als nur eine Platte mit elf Tracks vermutete. Und irgendwie ist IS THIS IT ja auch mehr: Die New Yorker brachten uns schließlich mit einer ordentlichen Ansage den Anti-Trend. Hier gibt es Garage Rock und keine breitbeinige XL-Produktion. Lieber singt Julian Casablancas Trivia-Storys mit Augenlidern auf Halbmast zum Lo-Fi-Sound, der sich nur zu gerne an frühere Werke der Stooges oder auch Velvet Underground schmiegt. (Hella Wittenberg)
Was danach geschah: Das Cover, auf dem eine behandschuhte Hand auf einem nackten Hintern von der Seite zu sehen ist, war für den US-Markt einfach zu viel – das Artwork musste ersetzt werden. The Strokes wählten schließlich eine abstrakte Abbildung eines Physik-Experiments.
17. Black Sabbath – BLACK SABBATH (1970)
16. Oktober 1969 in den Londoner Regent Sound Studios: Nach zwölf Stunden unter der Ägide von Produzent Rodger Bain befanden sich sieben Songs, prinzipiell das seinerzeit aktuelle Live-Repertoire der nach Boris Karloffs Horrorfilmklassiker benannten Band aus dem Großraum Birmingham, im Kasten. Dass ihr Debüt mal als erste LP des Metal-Genres, der Titelsong als erste Doom-Metal-Hymne in die Rock-Annalen eingehen sollte, davon ahnte die Band rein gar nichts. Zumal das in eindeutigem Artwork (im Ausklappcover tummelte sich ein auf den Kopf gestelltes Kreuz!) verpackte Werk mit seiner von Ozzy Osbournes Klagegesang umflorten archaisch-düsteren Wucht-Ästhetik sich zur provokanten Antithese der damaligen Jesus-Welle entwickelte. (Mike Köhler)
Was danach geschah: Veröffentlicht an einem Freitag, den 13., erwies sich das Debüt binnen Monaten als Bestseller.
16. A Tribe Called Quest – PEOPLE’S INSTINCTIVE TRAVELS AND THE PATHS OF RHYTHM (1990)
THE LOW END THEORY als alles überstrahlendes Referenzwerk hat der Rezeption des Debüts von A Tribe Called Quest lange Zeit ein wenig die Sicht verdeckt. Mit den Jahren jedoch hat sich der Fokus zugunsten dieses Albums neu justiert. Im Kollektiv Native Tongues, dem u.a. auch De La Soul, Jungle Brothers, Queen Latifah und Monie Love angehörten, hatten Q-Tip, Phife Dawg, Ali Shaheed Muhammad und Jarobi White Gleichgesinnte gefunden, hier entwickelt sich der Nährboden für ihren Conscious Rap, dessen Schwerpunkt auf Musikalität und die ebenso komplexen wie zurückgelehnten Arrangements für eine ganz neue Klangfarbe im urbanen HipHop sorgen. (Ingo Scheel)
Was danach geschah: Knapp anderthalb Jahre später erscheint besagter Meilenstein, THE LOW END THEORY.
15. Oasis – DEFINITELY MAYBE (1994)
Zwei Durchschnittstypen im Manchester der mittleren 90er, die halt doch keine Durchschnittstypen waren. Hochbegabter Songwriter und Gitarrist der eine, kolossaler Frontmann der andere. Dass im Leben nicht immer alles läuft, wie es laufen sollte, wussten sie, damit abfinden wollten sie sich nicht. „Rock’n’Roll Star“ ist der perfekte erste Song für ein erstes Album, „Live Forever“ lässt einen nie im Stich – und an manchen Tagen gibt es überhaupt nichts Besseres als die Gitarre am Anfang von „Supersonic“. Definitiv nie hat Britpop mehr Punch gehabt. (David Numberger)
Was danach geschah: 2009 lösen die Gallagher-Brüder die Band auf, natürlich im Streit. Was Show ist, was echt, ist dabei nie ganz klar. Gut möglich, dass Noel und Liam nicht zusammen Weihnachten feiern. Ausgeschlossen ist es aber auch nicht.
14. Billie Eilish – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? (2019)
An diesem Album ist gar nichts gefällig. Schon „!!!!!!!“ wirkt mit dem Gelächter von Eilish und ihrem Produzentenbruder Finneas eher wie ein Outtake statt eines typischen Openers. Aber wir haben es hier auch gar nicht mit so einem klassisch-homogenen Werk zu tun – vielmehr versammeln sich auf der Platte Songs, die sich in alle Richtungen drängen und dehnen. Mal balladesk, mal mit viel Trap und bratzenden Electrobeats besingt die zu dem Zeitpunkt 17-Jährige unerwiderte Liebe, Suizidgedanken, Momente des Selbst-Empowerns und lässt auch das drückende Gefühl von Isolation nicht aus. (Hella Wittenberg)
Was danach geschah: Das „!!!!!!!“, in dem Eilish zunächst geräuschvoll ihre Zahnspange herausnimmt, ist nur einer der vielen ASMR-würdigen Augenblicke des Albums, die die Sängerin letztlich auch zur Queen des Internetphänomens gemacht haben.
13. Leonard Cohen – SONGS OF LEONARD COHEN (1967)
Er hatte früher in einer Schülerband gespielt und sich ein paar Gitarrengriffe beigebracht, ansonsten war Cohen bis in seine Dreißiger hinein nicht groß am Musikmachen interessiert. Er wollte lieber Dichter sein, trieb sich in kanadischen Künstlercafés rum, eine Zeit lang auch in Griechenland. Andererseits ließ es sich als Singer/Songwriter in den 60ern ganz gut leben, Bob Dylan hatte es vorgemacht. Mit sanft-monotoner Stimme sang Cohen „Suzanne takes you down …“, und war ein Star. Auch „So Long, Marianne“ und „Sisters Of Mercy“ wurden Klassiker. Die karge Melancholie, die religiösen Bilder, die geheimnisvollen Frauen: Viel von dem, was Cohens Songs auch später ausmachte, war hier schon da. (David Numberger)
Was danach geschah: Cohen schrieb nebenbei weiter Gedichte, ein Jahr vor seinem Tod auch ein ziemlich großartiges über Kanye West.
12. The Jimi Hendrix Experience – ARE YOU EXPERIENCED (1967)
London-Heathrow, am 24. September 1966: Ein junger Gitarrist aus Seattle ist eben gelandet, wird demnächst zwei kompetente Mitstreiter an Bass und Schlagzeug engagieren, im Dezember die Single „Hey Joe“ veröffentlichen und mit denkwürdigen Club-Auftritten die Londoner Platzhirsche düpieren. Im Mai folgt das Debütalbum, oszillierend zwischen feedback-gesättigtem Psychedelic-Rock, entfesseltem Space-Age-Experiment und etwas Blues. Nur klingt all das bei Hendrix völlig anders als bei den braven britischen Blues-Jüngern: wild, kompromisslos, revolutionär. Ein Album als Gamechanger, als Weckruf für die Rockszene und vor allem die vermeintlichen Gitarrenhelden, denen vorgeführt wird, was sich für irre Klänge aus diesen sechs Saiten zaubern lassen, wenn man die Kraft der Elektrizität nur konsequent genug nutzt. (Uwe Schleifenbaum)
Was danach geschah: Zwei weitere offizielle Studioalben, legendäre Live-Shows, viel zu früher Tod.
11. The Stone Roses – THE STONE ROSES (1989)
Perfektion ist Sache der Götter? Von wegen. Das Debüt der Stones Roses funkelt auch über drei Dekaden nach seiner Entstehung wie pures Bernstein im Sonnenlicht. Das hypnotische „I Wanna Be Adored“ zum Auftakt, der schillernde Britpop von „She Bangs The Drums“ und „Waterfall“, der Groove von „Made Of Stone“, das orgiastische „I Am The Ressurection“ zum Ausklang, mit seinem Bogen von Rave zu QUADROPHENIA, und alles dazwischen, wie Perlen an einer Schnur, von Klangjuwelier John Leckie auf Hochglanz poliert. Vielleicht ein Grund, warum es den Mannen aus Manchester nie so wirklich gelingen sollte, ihr Debüt in adäquater Form auf die Bühne zu bringen: Eine Sternenkonstellation wie diese gibt es alle paar Jahrhunderte nur einmal. (Ingo Scheel)
Was danach geschah: Fünf Jahre Wartezeit auf SECOND COMING, das zweite Album, für das bis heute nur ein Plätzchen im Schatten geblieben ist. Split 1996, Reunion 2011, die neben einer Tour nur zwei Singles hervorgebracht hat. Erneuter Split 2017.
10. De La Soul – 3 FEET HIGH AND RISING (1989)
Als HipHop drauf und dran war, sich in Positionskämpfen und Aufmerksamkeitsdebatten zu wichtig zu nehmen, kamen diese Boys und spielten sich die Bälle in einem selbst geschaffenen Klangraum mit lauter irritierenden Verweisen zu. De La Soul entwickelten eine Spielform, in der der Kommentar gleichberechtigt neben der Musik stand. HipHop als Skit-Programm, eine Sammlung aus Rhythmen, Reimen, Noise und Sonnenschein, 23 Tracks mit Spielzeiten zwischen 37 Sekunden und knapp fünf Minuten, zum Finale ein Willkommensgruß aus dem „D.A.I.S.Y. Age“. Beste Unterhaltung mit einem Distanzhalter zu Gangsta Rappern, politischen Schwergewichten und Style-Rebellen, geboren in den Plattensammlungen der suburbanen Elternhäuser und befeuert von den frisch erworbenen Produktions-Skills von Prince Paul. Als Outsider definierten De La Soul ein neues In-Sein im HipHop. (Frank Sawatzki)
Was danach geschah: 1991 folgte ein bemerkenswert unspaßiges Lebenszeichen: DE LA SOUL IS DEAD.
9. Bon Iver – FOR EMMA, FOREVER AGO (2007)
Die Story hinter diesem Album, sie ist fast zu gut, um wahr zu sein: Der 25-jährige Justin Vernon verschanzt sich einen guten Winter (französisch: „bon hiver“) lang in der Jagdhütte seines Vaters, um eine Lungenentzündung, Pfeiffersches Drüsenfieber, Online-Poker-Spielsucht und akuten Trennungsschmerz auszukurieren. Dabei knallt er Rehe ab, um sich zu ernähren, Papa bringt alle zehn Tage Bier vorbei, und Vernon schreibt Songs, inspiriert von Springsteen-Lyrics und choralen Harmonien der Wiener Sängerknaben. Sein hypnotisches Falsett, das er gern in acht Spuren übereinanderlegt, erinnert an die Apachen. Am Ende des Winters glaubt Vernon, okaye Demoversionen auf Band zu haben – bis er schnallt: bisschen Trompete und Posaune drauf und schon ist das Album perfekt. (Stefan Hochgesand)
Was danach geschah: Auch im Debüt setzt Bon Iver schon Auto-Tune ein. Später scheint er Cher Konkurrenz machen zu wollen, was den Exzess angeht – und macht das Mainstream-Stilmittel somit auch indiesalonfähig.
8. N.W.A. – STRAIGHT OUTTA COMPTON (1988)
Provokationen, unabsichtlich oder kalkuliert, verschaffen Aufmerksamkeit. Dieses Album steckte voll davon. Eingebettet in eine düstere Klangcollage aus Schreien, Four-Letter-Words, Sirenen, Schuss- und Fahrgeräuschen wie aus einem Crime-Movie, verhalfen die mit sinistrer wie vehementer Funk-Besessenheit produzierten 13 Tracks sowohl Niggaz Wit Attitudes als auch den Gangsta- und Westcoast-Rap auf die globale Landkarte zu setzen. Titelsong, „Gangsta Gangsta“, „If It Ain’t Ruff“ wie auch „Parental Discretion Iz Advised“ operierten schon auf des Messers Schneide. „Fuck Tha Police“ traf nicht nur ein Bann sämtlicher Radiostationen und MTV, sondern zog Boykott von LP und Band durch zahlreiche Verbände sowie ein offizielles Schreiben des FBI an das Label Ruthless / Priority / EMI nach sich – was Medieninteresse und Absatzzahlen regelrecht explodieren ließ. Zentrale Message: Bei der Schilderung des Ghetto-Gang-Lebens fiel die bis dato gewohnte Sozialkritik zugunsten von hedonistischer bis nihilistischer Verherrlichung flach. (Mike Köhler)
Was danach geschah: N.W.A. verpufften 1991, schoben Solokarrieren an, wiedervereinigten sich mehrmals. Eazy-E verstarb 1995 an AIDS.
7. The Doors – THE DOORS (1967)
Laut Autor Nik Cohn schien Jim Morrison anfangs „nur ein wunderschöner Junge in schwarzem Leder zu sein, der aussah, als hätten ihn sich zwei Schwule am Telefon ausgedacht“, doch bald „entpuppte er sich als etwas sehr Ernstzunehmendes“. Konkret: als unberechenbarer, literarisch bewanderter und dem Exzess verpflichteter Vorreiter dessen, was man gemeinhin unter dem Begriff „Gothic“ subsumiert. Bereits das Debütwerk strahlte – auch jenseits von „The End“ – in jenem immanenten Zwielicht, das Pop-Frohnaturen schaudern ließ, doch Außenseiter, Melancholiker und Suchende umso magischer anzog. Musikalisch umrahmt von perlenden Gitarrenklängen, Latin-Jazz-Schlagzeug und einer barock bis orientalisch mäandernden Orgel. Aber im Zentrum stand Morrisons warmer Bariton, der ein bacchantisches „sweet delight“ auf die Verdammnis der „endless night“ reimte. (Uwe Schleifenbaum)
Was danach geschah: Fünf Studioalben, Skandalshows, mythenumrankter Tod in Paris.
6. Joy Division – UNKNOWN PLEASURES (1979)
Als Ende der 70er dieser Meilenstein der damals noch blutjungen Postpunk-Geschichte erschien, geschah … erst mal nichts. So groß der Eindruck sein mag, den das Debüt von Joy Division auf einen ganzen Sound und die Stimmung einer Epoche besaß, so gering war indes der Impact bei Erscheinung. Die Aufnahmen in den Strawberry Studios in Stockport hatten an den Wochenenden stattfinden müssen, da die Band werktags noch Lohnarbeiten nachging. Eine erste Auflage von 10 000 Exemplaren verkaufte sich schleppend. Um die Qualität des Materials, zu dem unter anderem Stücke wie „Disorder“ und „She’s Lost Control“ gehören, ins Licht zu rücken, bedurfte es des Nachfolgewerks: CLOSER, der Hit „Love Will Tear Us Apart“ und leider auch der Suizid von Sänger Ian Curtis am 18. Mai 1980 brachten der Band die größere Wahrnehmung, die dann auch ihrem Debüt zum Kult verhalf. (Linus Volkmann)
Was danach geschah: Das Cover-Artwork der Platte mit den wellenförmigen Radio-Amplituden ist heute ein beliebtes Nerd-Meme.
5. Björk – DEBUT (1993)
Björks erwachsenes Solodebüt (entstanden nach den drei Alben mit ihrer Postpunk-Band The Sugarcubes) ist der perfekte Einstieg ins Björk’sche Œuvre. Entgegen aller Unkenrufe, wie ach so sperrig und verschroben Björks Musik sei, ist DEBUT ihr bis heute größter kommerzieller Erfolg, entstanden mit Mainstream-Produzent Nellee Hooper (U2, Madonna), sehr zugänglich, zumal man heute hört, was sie da alles angestoßen hat: Ohne Björk wären Grimes und FKA Twigs undenkbar. Aber auch Robyn und Lada Gaga, die 2013 ihr Album nach dem betitelte, was Björk exakt 20 Jahre vorher schon machte: Artpop. Die Songs sind in Björk ein Jahrzehnt lang gereift, doch die Arrangements hat sie in ihrer damals neuen Heimat London geschliffen, deren Untergrund-Clubwelt sie ganz benebelt hat. DEBUT ist house-clubby, ist acid-jazzy und eine Absage ans öde Grunge-Gitarren-Einerlei derzeit. (Stefan Hochgesand)
Was danach geschah: Der Nachfolger POST in- und exhaliert den frischen TripHop von Portishead, aber auch die Intelligent Dance Music von Aphex Twin. Bis heute hat Björk beste Frühwarn-Antennen für neueste musikalische wie popkulturelle Trends (auch die Beats von Arca und The Haxan Cloak). Dadurch klingt sie selbst stets frisch – und ist das größte lebende Hyper-Gesamtkunstwerk.
4. Roxy Music – ROXY MUSIC (1972)
Die Tragik ist, dass alles schon mal da war, jede Emotion ausgedrückt wurde, auf jede Art. Egal wie emphatisch, romantisch, was auch immer man zu sein versucht: Man gerät in Distanz zu sich selbst. Alles gerinnt zur Pose, zum Kitsch. Bryan Ferry hatte Anfang der 70er ein Kunststudium bei Richard Hamilton hinter sich. Jetzt wollte er Verfahren der Pop-Art – Dekonstruktion, Collage, Zitat – auf die Popmusik übertragen. Der erste Song „Remake/Remodel“ formuliert das Programm im Titel. Wenn es keine Originalität mehr gibt, setzt man das, was da ist, neu zusammen und schafft sich eine neue Originalität. Ferry singt affektiert, theatralisch, imitiert Jazz-Stimmen der 40er, Popsänger der 50er. Die Saxofon-, Klavier- und Gitarrensolos wirken wie ausgestellt, dazu Brian Enos irre Synthesizer. In „The Bob“ hallt der Zweite Weltkrieg nach. Glamour, Fashion, Avantgarde, Art-Rock: ein Album, als wäre die Popmusik schnell angehalten, angeschaut, kommentiert und auf einer anderen Reflexionsebene wieder aufgenommen worden. (David Numberger)
Was danach geschah: Die triumphale Single „Virginia Plain“ kam erst mit der US- Ausgabe aufs Album. Eno stieg bald danach aus, Ferry führte die Band später konsequent in Richtung eingängigen Hochglanz-Pop.
3. Portishead – DUMMY (1994)
Klar, es gab auch Massive Attack, die sogar ebenfalls aus Bristol kamen. Aber wenn wir ehrlich sind: Selten stand eine Platte so singulär für einen ganzen Sound wie DUMMY für Trip-Hop. Alles, was man dem Genre attestiert, hier findet man es in Perfektion. Plattenknistern, eine in Mitleidenschaft gezogene Scratch-Nadel, verschleppte, schwere Beats, Samples aus einer weit entfernten Vergangenheit, diese unheimlich trostlose Grundstimmung, die Grunge im 90er-Vergleich fast wie Fun-Punk klingen ließ und dazu dieser stimmliche Kontrast. Wir müssen, natürlich, über Beth Gibbons sprechen. Ihre Stimme klagt, weint und leidet, aber so elegant, so vollgesogen mit Emotionen. All das klingt so wunderschön, dass man sich fast nicht trauen möchte, es zu genießen, weil allen elf Songs diese Einsamkeit und Verzweiflung innewohnt. Kein Wunder bei Zeilen wie „And this loneliness. It just won’t leave me alone“. Musik, die nie für die große Bühne gedacht war und sie doch erreichte. (Christopher Hunold)
Was danach geschah: Drei Jahre später erschien der selbstbetitelte Nachfolger. Auf THIRD mussten Fans elf Jahre warten. Und das war 2008. Geoff Barrow ist heute Kopf der experimentellen Krautrock-Band Beak>.
2. Sex Pistols – NEVER MIND THE BOLLOCKS, HERE’S THE SEX PISTOLS (1977)
Da kann Johnny Rotten noch so misanthropisch sein, das Debüt, das einzige „echte“ Album der Sex Pistols, ist eine Mannschaftsleistung. Mit Chris Thomas und Bill Pryce konnte Teamchef Malcolm McLaren auf ein mit allen Wassern gewaschenes Produzententandem vertrauen. Thomas etwa hatte bereits mit Pink Floyd, den Beatles und Roxy Music gearbeitet, Kettenraucher Pryce gehörte ebenfalls zu den Besten seines Fachs. Als Vorteil erwies sich, dass Gitarrist Steve Jones und Drummer Paul Cook eine von unablässigem Proben gestählte Achse bildeten, die selbst das musikalische Herz der Band, Bassist Glen Matlock, eingestiegen, zu kompensieren wussten. So fügte es sich, dass diese Platte nicht nur durch den Parolenreichtum Rottens besticht, sondern sich auch in klanglicher Hinsicht und in puncto Songwriting als komplett zeitresistent erweisen sollte. Und dann ist da ja auch noch das Artwork von Jamie Reid. Der Queen tackerte der britische Künstler und ausgewiesene Situationisten-Anhänger bereits die Erpresserbrief-Buchstaben quer übers Gesicht, sein Knallgelb-Pink-Design von NEVER MIND THE BOLLOCKS geriet zum ikonischen Referenzwerk. (Ingo Scheel)
Was danach geschah: Tod, Split, Reunion, Rock’n’Roll- Schwindel, Prozesse, nur keine neue Platte mehr.
1. The Velvet Underground & Nico – THE VELVET UNDERGROUND & NICO (1967)
„A left-fielder, which could click in a big way.“ Dieses hellsichtige Fazit zog das „Billboard“-Magazin in seiner Ausgabe vom 4. März 1967. In der „Tampa Tribune“ schrieb kurz darauf ein gewisser Vance Johnston: „THE VELVET UNDERGROUND & NICO is several confusing sounds mixed by Andy Warhol, most depressing and whatever the message I failed to get. It’s rock with a sadistic touch, I suppose but at any rate Warhol’s fans will surely declare this his best.“ Dazu muss man wissen, dass „Billboard“ eine Branchenzeitschrift war, die „Tampa Tribune“ hingegen eine zwar Pulitzer-Preis-dekorierte, aber letztendlich ländlich-konservative Tageszeitung.
Auf lange Sicht hat „Billboard“ recht behalten. Betrachtet man die unmittelbare Rezeption, waren aber die Floridaianer näher am Puls der Zeit. Obwohl auf dem auch damals wohlgelittenen Verve-Label erschienen, verpuffte THE VELVET UNDERGROUND & NICO, das Debütalbum der aus Lou Reed, John Cale, Maureen Tucker, Sterling Morrison und Christa Päffgen alias Nico bestehenden Band schnell. Ein Rechtsstreit mit dem Schauspieler Eric Emerson, der auf der Hinterseite des ursprünglichen Artworks zu sehen war, sorgte zudem dafür, dass das Album nach nur drei Monaten erst einmal vom Markt verschwand. Die Charts-Positionen lesen sich entsprechend ernüchternd: Eine Nummer 171 im Dezember 1967 war das Höchste der Gefühle.
Eine kurze Erinnerung: Auch wenn 1967 das Jahr war, in dem zahlreiche Psychedeliker ihre Debütalben veröffentlichten, spielte diese Musik im Massengeschmack gerade der ländlichen USA keine allzu große Rolle. Die Popgruppe, die am besten verkaufte, waren die Monkees, die sich zwar langsam von ihrer Plattenfirma emanzipierten, aber im Vergleich zu The Velvet Underground natürlich kreuzbrav klangen. Und: Selbst das ebenfalls 1967 veröffentlichte Debütalbum einer Band wie der Doors mag etwas gewesen sein, dass Erwachsene ablehnten, an dem sie sich rieben. Doch der Grund ihrer Ablehnung war recht genau zu benennen, sie waren ein einfacher Feind. The Velvet Underground dagegen brachten viele nur blankes Unverständnis entgegen. So etwas wie „European Son“, mit seinen übereinander, ineinander, gegeneinander laufenden Spuren, mit seinen Dissonanzen, seinen Rückkopplungen, seiner kaum erkennbaren Struktur, war das denn wirklich Musik? Und musste man wirklich so uncodiert über „Heroin“ singen? Und den Typ, der das einem, der man „sick and dirty, more dead than alive“ an einer Straßenecke wartete, verkaufte?
Ein Kunstwerk, das sich auch heute noch jeder Deutung entzieht, dem man sich gleichzeitig nicht entziehen kann
Musste man. THE VELVET UNDERGROUND & NICO ist ein Album, das aus kleinen Gesteinssplittern ein Kunstwerk zusammensetzt, das sich auch heute noch jeder Deutung entzieht, dem man sich gleichzeitig nicht entziehen kann. Es schlug Funken, die damals kaum sichtbar waren, aber zu verschiedenen Schwelbränden führten; weniger in der Musik der 60er- als in jener der 70er-Jahre: Auf dieser Platte werden die Songs niemals aus- oder gar aufgefüllt oder enden im sogenannten Jam. Vielmehr handelt es sich bei ihnen um raue, widerborstige Strukturen, die entweder freidrehen oder in Schleifen laufen, die niemals das Gesungene (bzw: Gesagte) verdecken, sondern es im Gegenteil noch verstärken. Die Handlung dieser Songs, sie liegt so deutlich vor einem, wie das später im Punk der Fall war.
Die Art, wie Avantgarde scheinbar mühelos in diese Songs hineinfließt, wie der klassisch ausgebildete Cale mit Stimmungen arbeitet, wie er sich von John Cage gleichermaßen beeinflussen ließ wie von seinem Spiel mit Terry Riley, La Monte Young und Marian Zazeela und deren Theatre of Eternal Music, ist ebenso bedeutsam für die Folgegeschichte der Popmusik. Und Andy Warhol, der die Rolle des Produzenten auf eine gänzlich andere Art und Weise ausführte, als das bis dato Usus war, natürlich auch: Er war keiner, der am Regler saß. Er war nicht mal einer, der im Studio sonderlich präsent war, diesen Part übernahm Verve-Mann Tom Wilson. Vielmehr war Warhol der Produzent der Idee The Velvet Underground, die er 1966 entdeckt und für sein Performance-Projekt „Exploding Plastic Inevitable“ rekrutiert hatte. Er war es, der ihnen die deutsche Sängerin Nico zur Seite stellte – beziehungsweise vor die Nase setzte: Weder Reed noch Cale oder Tucker waren sonderlich begeistert –, ohne die die Band kaum einen Plattenvertrag bekommen hätte.
Sie singt die schönsten Lieder auf dieser Platte, gleichzeitig verdreht sie tradierte Rollenbilder: Während Lou Reed im lichtdurchfluteten Opener „Sunday Morning“ zum Glockenspiel Zärtlichkeiten in den Hallraum haucht, besitzt ihre Stimme in „Femme Fatale“, vor allem aber in „All Tomorrow’s Parties“, das mit seinem präparierten Klavier so klingt, als hätte ein Kammerpop-Song einen Autounfall gehabt, eigenartige Ungerührtheit.
Es dauerte bis in zweite Hälfte der 70er-Jahre, bis all das tatsächlich gehört wurde. „It never stops getting better“, schrieb der Musikjournalist Robert Christgau in der New Yorker „Village Voice“, die sich beim Erscheinen des Albums wenig begeistert gezeigt hatte. Auch Brian Eno gehörte zu den Fürsprechern: Von ihm stammt der oft zitierte Satz mit den 30 000 Exemplaren, die THE VELVET UNDERGROUND & NICO verkaufte, die aber jeweils zur Gründung einer Band geführt hätten. Ist natürlich Unsinn. Aber das Album begründet eine Ahnenlinie, die uns über Television, Sonic Youth und die Strokes bis in die Gegenwart führt. (Jochen Overbeck)
Was danach geschah: Eine ganze Menge. Dieses Album hatte Auswirkungen auf so ziemlich jede Band, in der jemand eine Gitarre hielt. Die Songs sind vielfach gecovert worden, am schönsten vielleicht von der Wiener Band Die Buben im Pelz, die die ikonische Cover-Banane durch eine Wurst austauschten.