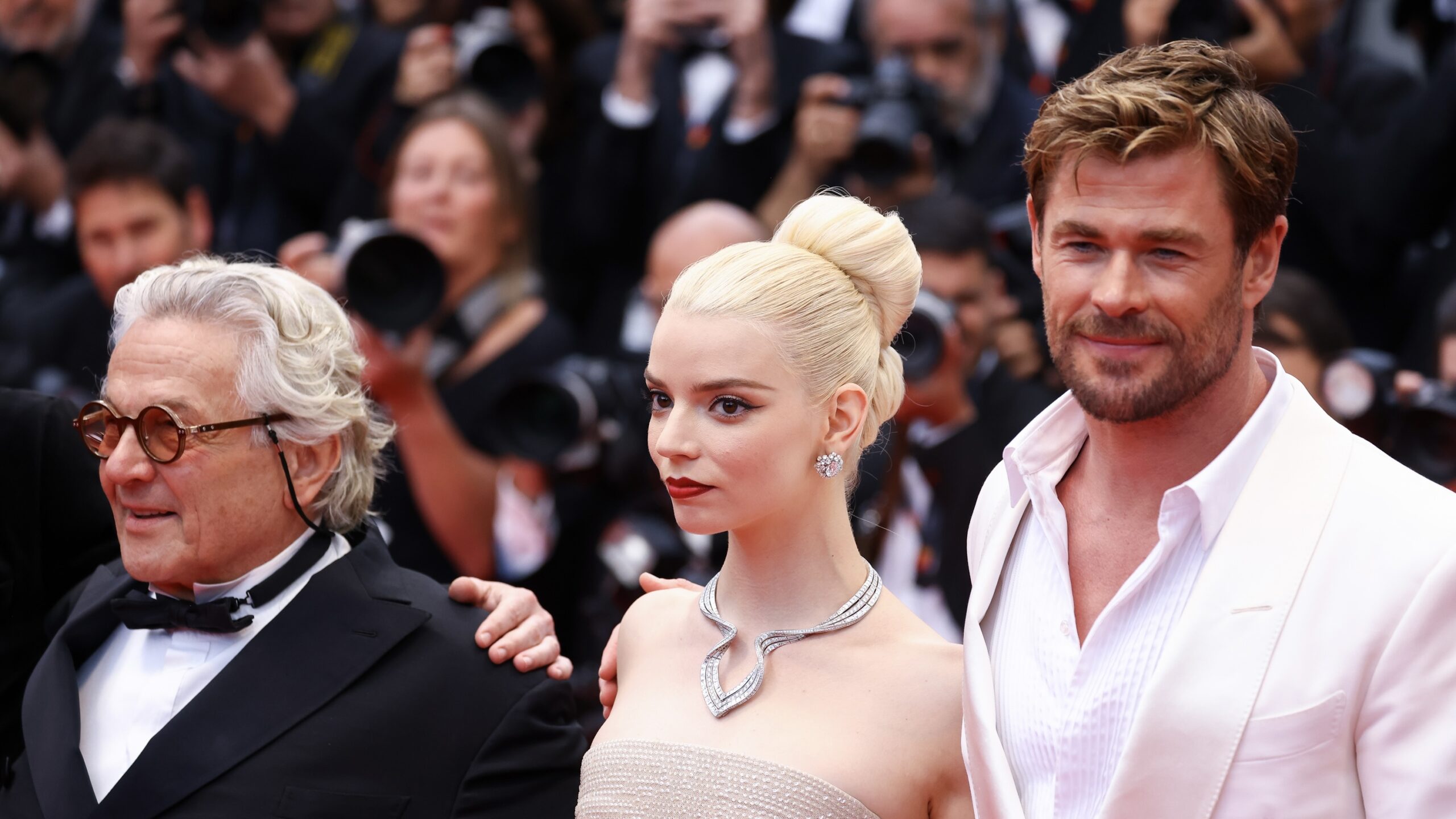„Oppenheimer“: So spannend und imposant kann Physik sein
Christopher Nolan lässt ein altes Thema neu relevant werden. Cillian Murphy gibt dabei das personifizierte schlechte Gewissen.

Seit Monaten ist „Oppenheimer“ in aller Munde, dabei bezieht man sich weniger auf die historische Figur, den Physiker, als auf den Film und Hype darum. Auch wenn das Werk auf dem Pulitzerpreis-gekrönten Buch „J. Robert Oppenheimer: Die Biografie“ von Kai Bird basiert – der wie der Name schon sagt, den echte Persönlichkeit und sein Leben dahinter thematisiert, ist für viele spannender, was ein visionärer Regisseur wie Christopher Nolan visuell und philosophisch herausgeholt hat aus dem Material. Braucht man denn jetzt eine Verfilmung dieses alten Stoffes? Wie sehr kann Physik wirklich ein Mainstream-Publikum interessieren?
Der Film zeigt uns nun, wie der theoretische Physiker durch die Konstruktion einer Bombe während des Zweiten Weltkrieges für Frieden sorgen will und erst nach der Erschaffung dieser merkt, welche Konsequenzen seine Entdeckung mit sich bringt. Eine Story, die in der Umsetzung erst mit ordentlich Anlauf gut für die Zuschauenden funktionieren will – aber dann doch seine ganze überwältigende Bedeutsamkeit zu entfalten weiß. Hier kommt unsere Review.
Das innere Dilemma eines Physikers
„Oppenheimer“ nimmt uns mit auf eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit und resümiert, wie die Atombombe in den 40er-Jahren entstanden ist. Dabei geht es allerdings um weitaus mehr als nur theoretische Formeln. Cillian Murphy gibt hierfür J. Oppenheimer, den amerikanischen Physiker mit jüdischer Abstammung. In der Materie liegt nicht nur sein Interesse, sondern seine Leidenschaft. Während des Zweiten Weltkrieges möchte er sein Können dafür nutzen, um die Nazis zu stoppen. Nachdem Oppenheimer Hitlers Ansage Polen einzunehmen, mitbekommt, befürchtet er, dass die Deutschen im Besitz einer mächtigen Bombe sein könnten. Er beschließt also Teil vom „Manhattan-Projekt“ zu werden, in dem man sich der Entwicklung einer neuartigen Waffe widmet – mit dem Ziel, eine größere Bombe als die Nazis zu konstruieren und so den Zweiten Weltkrieg beenden zu können.
Unter der Regie von Christopher Nolan („Interstellar“, „Tenet“) werden in dem dreistündigen Werk die Zuschauer:innen in den Prozess der Erschaffung mitgenommen, die einige Hürden mit sich bringt. Nach jahrelanger Arbeit und Druck seitens der US-amerikanischen Regierung gelingt es Oppenheimer, die ultimative Nuklear-Waffe zu entwickeln. Was zunächst zelebriert wird, führt später zu Angst und Selbstkritik, als die Bombe 1945 gegen die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zum Einsatz kommt.
Während Amerika sich stärker denn je fühlt, zerbricht Oppenheimer an nagenden Schuldgefühlen. Seine Kritik an der Nutzung dieser Waffe führt ihn schließlich zu noch mehr Problemen. Hierbei nimmt der Film einen von den Anfängen seiner Karriere bis hin zu seiner Sicherheitsberechtigung 1954 mit. Letztere führt zum Verhör von Oppenheimer und seinen Mitarbeiter:innen. Der Grund: Beim Physiker liegt der Verdacht vor, dass er ein Kommunist sein könnte, was in der McCarthy-Ära vielen Politikern missfiel.
Ein zähes Stück Film folgt und die Frage nach Ausharren oder Aufgeben flackert schon das ein oder andere Mal im Kopf auf. Doch Durchhalten lohnt sich. Wir schwören.
Fast 30 Jahre Lebensgeschichte in drei Stunden erzählt
Die Handlungen machen es durchaus nachvollziehbar, weshalb das Werk die Dauer von drei Stunden in Anspruch nehmen muss. Schließlich zeigt es, wie Oppenheimer zu Anfängen seiner Karriere nachts in seinem Bett wachliegt und sich mit Sternen, Atomen und physikalischen Unmöglichkeiten beschäftigt. Dies erlaubt einen smoothen Einstieg in die schwere Thematik, die auch mal dröger dargeboten wird, wenn das Verfahren gezeigt wird, in dem seine Loyalität gegenüber Amerika diskutiert wird.
Dem wird aber im großen Ausmaß auch die menschliche Seite Oppenheimers gegenübergestellt und mithilfe von Liebesgeschichten neben der Atombombenproblematik auch eine Mehrdimensionalität präsentiert, die auch seine inneren Widersprüche mit den Sujets leichter verständlich machen sollen.
Auch wenn der Fokus der Geschichte auf trockenem Expert:innen-Physik gesetzt ist, schafft es der Film diese im Mix der Nuancierungen spannend zu gestalten. Durch den Einsatz von mutigen Soundeffekten und der Verbildlichung der Formeln ist „Oppenheimer“ doch nie in Dauer zu langatmig, sondern greifbar und das Mitdenken lohnt sich.
So wie den Zuschauenden Zahlen und Codes spielerisch näher gebracht werden sollen, lässt Nolan auch viel Zeit und Fokus für die Gefühle seines überhaupt nicht easy einzuordnenden Protagonisten. Murphy liefert eine seiner subtilsten schauspielerischen Leistungen ab – dem gegenüber stehen manche zu sehr mit dem Hammer servierten Innenansichten Oppenheimers, wie schummrige Bildwelten oder krasse Fantasievorstellungen.
Die Besetzung ist auch neben Murphy top gewählt: Florence Pugh (die Affäre), Emily Blunt (die Ehefrau) sowie Robert Downey Jr. und Matt Damon liefern präzise ab und schaffen Empathie und emotionale Momente in einer sonst eher trockenen Storywelt.
Und klar braucht es solch eine Art von Kontextualisierung, um die Geschichte zu verstehen und für die große Leinwand interessant zu machen, doch ist der am Anfang des Streifens schon wirklich sehr großzügig gewählt. Durch Zeitsprünge, die in dem Film durch Wechsel zwischen digital und in Farbe gefilmten sowie analogen Schwarz-Weiß-Szenen kennzeichnet sind, werden Gespräche nicht so schnell fade. Dennoch fragt man sich in den ersten 30 Minuten und der gefühlten hundertsten Anspielung auf dramatische Folgen, wann es endlich richtig losgeht. Wo ist die Story, Leute?
Denn ernsthaft: Oppenheimers Ursprungsidee und seine Passion würden auch in weniger Zeit gut verständlich sein, dafür müsste tatsächlich nicht immer wieder Cillian Murphy gezeigt werden, der jede Nacht über Sterne nachdenkt oder auch mal Weingläser an die Wand wirft, weil ihn der Bruch davon fasziniert.
Theorie näher gebracht
Immerhin: Hat man aber dem langen Intro ins Thema standgehalten, warten unheimlich faszinierende Szenen, Soundeffekte und perfekt passende Musikeinsätze auf einen, die es sogar schaffen, dass man in so ein theoretisches Thema wie Physik komplett hineingezogen wird.
Fazit: Um das Ende des Filmes zu kennen, muss man nicht J. Robert Oppenheimers Biografie gelesen haben. Denn den meisten dürfte der Angriff auf Hiroshima und Nagasaki ein Begriff sein. Dennoch ist es spannend, dem Prozess einer Entdeckung beizuwohnen und im Detail die menschliche Seite an dem Physiker kennenzulernen. „Oppenheimer“ will uns gerade mit sehr vielen Effekten von sich überzeugen, wenn die inhaltliche Auflösung eine so bekannte ist.
Und speziell in den Szenen, in denen die Bomben getestet werden, wird man durch die Schauspielkunst der Darsteller:innen, aber ebenfalls durch den gezielten Einsatz von leiser oder lauter werdenden und verspäteten Soundeinsätzen in eine unheimlich hohe Spannungskurve hineingerissen.
Was „Oppenheimer“ am Anfang an knackigen Einsatz und Dramaturgie verpasst, wird am Ende dafür doppelt und dreifach nachgeholt. Ein episches Meisterwerk, über das man noch lange nachdenken wird.
„Oppenheimer“ ist ab dem 20. Juli in Deutschland in den Kinos zu sehen.