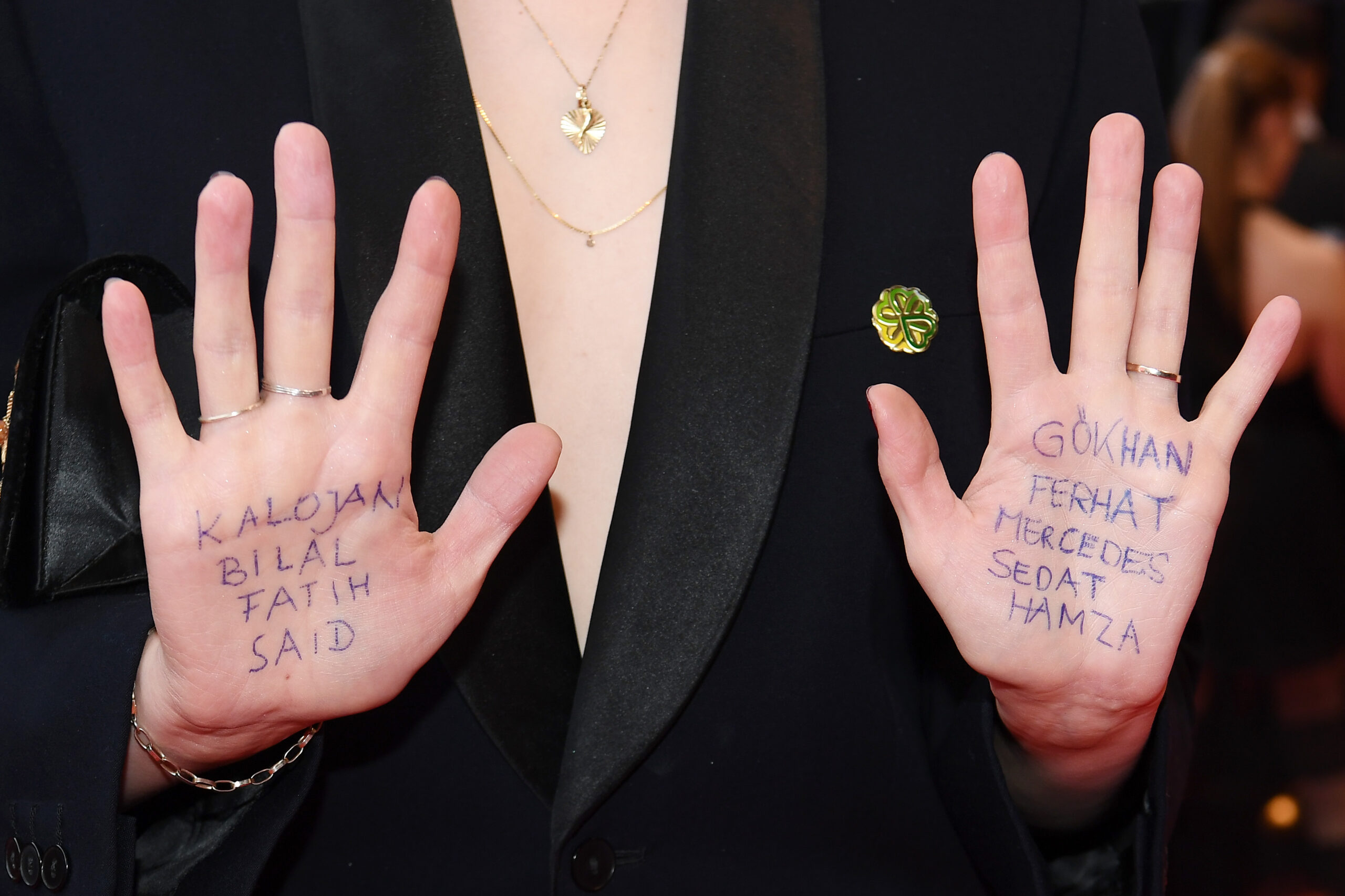Reggae – Die Rockrebellen aus der Dritten Welt
Bei weißhäutigen Rockgruppen gehört es mittlerweile zum guten Ton, mindestens eine Reggea-Nummer im Repertoire. Aber auch in der Originalverpackung hat sich der Sound aus Jamaika jetzt endgültig durchgesetzt: in England bevölkern die Rastas schon seit einem Jahr die Hitparaden, in Frankreich kassierte Bob Marley eben erst zwei goldenen Schallplatten und in Deutschland brachte der Herbst '78 einen gänzlich unerwarteten Reggae-Boom. Höchste Zeit also, einmal zusammen zu fassen, was sich hinter dem Schlagwort Reggae verbirgt. Harmann Haring berichtet über Jah und Jamaika, Dub und Dread, I-roy und U-Roy, Toots und Roots, Big Youth und big spliffs.

Nehmen wir zum Beispiel Hamburg. Eine lebendige Metropole mit knapp zwei Millionen Einwohnern und einer renommierten Musikszene: Lindenberg, Lake, Inga Rumpf, Truck Stop, Caro 4 The JCT-Band, Jutta Weinhold, Achim Reichel und so weiter. Viele Clubs für Live-Konzerte, Stammsitz etlicher großer Plattenfinnen und Hochburg der Musikpresse. Im Ausland hat der Sound aus Hamburg gleichwohl kaum Wellen geschlagen. Kleinere Erfolge in verschiedenen Ländern und als Krönung über 200.000 verkaufte Lake-Platten in den USA. Mehr nicht.
Und nun Jamaika. Eine Insel, mit ebenfalls rund 2 Millionen Einwohnern. Und einer Musikszene, für die das Wort Reggae steht. Eine Spielart des Rock, die im Schmelztiegel Kingston, der spannungsgeladenen Hauptstadt des Inselstaates, aus – grob gesagt – karibischer Folklore und amerikanischem Rhythm & Blues geschmiedet wurde. Während Hamburger Musiker mit Ausnahme von Lindenbeig und Reichel anglo-amerikanischen Rock möglichst naturgetreu nachempfinden, ist Reggae eine ureigene Erfindung der Jamaikaner. Eine Erfindung, auf die die Rock weit heiß ist: In England sind Reggae-Nummern Stammgast in den Hitparaden und belegen mehr und mehr Spitzenplätze. In den USA und in Frankreich kassiert Bob Marley Goldene Schallplatten. In Deutschland machten Discotheken Reggae-Titel wie „Cocaine In My Brain“ von Dülinger oder „Up Town Top Ranking“ von Althea & Donna zu Hits. In Westafrika, speziell in Nigeria, werden jamaikanische Reggaescheiben zu Hunderttausenden verkauft. Frank Farian zaubert aus altbekannten Reggae-Songs Welthits für Boney M. („Rivers Of Babylon“). Johnny Rotten liebt Reggae, die Rolling Stones produzieren ihn für ihre eigene Plattenfirma (Peter Tosh), Eric Clapton spielt Reggae („I Shot The Sherifr) und Smokie versucht es (It’s My Life“). „Schaut her, was alles von dieser kleinen Insel kommt!“ sagt lächelnd Bob Marley. Und: „Reggae ist wie Wasser, Mann. Du kannst ihn nicht stoppen!“
Nach drei Jahren, in denen Reggae außerhalb von England und Jamaika der heißeste Geheimtip der Rockszene war, ist 1978 ein wahrer Reggae-Boom angelaufen. Man merkt’s vor allem an den steigenden Plattenumsätzen und an der Unmenge von Songs im Reggae-Rhythmus, die nicht von den Erfindern dieser Musik, sondern vielmehr von weißen Rockern in die Welt gesetzt werden. Und man hört Bemerkungen wie die eines Mitarbeiters des Plattenkonzerns EMI, Peter Tosh habe was die Gagen anbelange – schon viel von Mick Jagger gelernt. Reggae, das ist klar, gerät derzeit in die Vermarktungsmangel der europäisch/amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Die Musik selbst wird dabei womöglich ein Stück ihrer Ursprünglichkeit und Wärme verlieren. Und das Massenpublikum, das sich auf sie einklinkt, wild die Geschichte, die zur Entstehung des Reggae führte, still übergehen. Denn diese Geschichte ist eine bittere Geschichte. Die Bitterkeit in sie hineingetragen haben vor allem Europäer.
Jamaika, die Heimat des Reggae, wurde erst 1962 ein unabhängiger Staat. Vorher war sie jahrhundertelang eine ausgebeutete europäische Kolonie. Kolumbus betrat sie Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Er war, wie wir wissen, im Auftrage des spanischen Königshauses unterwegs, um Gold und alle sonstigen greifbaren Reichtümer herbeizuschaffen. Er, der in europäischen Geschichtsbüchern später fälschlicherweise als Entdecker Amerikas gefeiert wurde, ebnete den Weg für eine kurze, aber gründliche Invasion spanischer Glücksritter. Im Namen Jesu Christi rotten sie in Jamaika – wie überall auf den Westindischen Inseln und in Mittelamerika – die indianische Urbevölkerung kurzerhand aus. Von diesen Indianern lebt heute mit ziemlicher Sicherheit kein Nachkomme mehr. Immerhin: ihr Name ist noch erhalten. Sie hießen „Arawaks“ und tauchen in einigen Reggae-Songs auf (etwa in „Pirate Days“ von Culture).
Die Spanier hielten sich nur eineinhalb Jahrhunderte in Jamaika, genau bis 1655. Sie drückten der Insel in dieser Zeit aber einen grausamen Stempel auf, der sie bis ins 20. Jahrhundert hinein prägte. Um 1500 trafen bereits die ersten Sklaven auf der Insel ein. Sie wurden benötigt für die Intensivierung des Zuckerrohranbaus. Denn damit und nicht mit dem kaum vorhandenen Gold war das große Geld zu machen – das hatten die Spanier schnell gecheckt. Die Sklaven waren zunächst noch weißhäutig – aus Europa importierte Sträflinge. Schon zwanzig Jahre später hatten sich die Spanier jedoch fest genug in Westafrika eingenistet, um Neger en gros über den Atlantik zu transportieren. Das waren die billigsten Arbeitskräfte, die man sich vorstellen kann. Sklavenjäger fingen sie in Afrika ein, schlugen sie halb- oder ganz tot, wenn sie nicht parierten, pferchten sie in stinkende Schiffsleiber und brachten sie in die Karibik. Dort wurden sie verkauft an jene Spanier, die sich hier mittlerweile das fruchtbare subtropische Land unter den Nagel gerissen hatten. Auf diese Weise konnte höchst preiswert Zucker angebaut, nach Europa verschifft und dort mit gutem Gewinn verkauft werden.
Zwischen 1650 und 1660 wurden die Spanier allerdings aus diesem Paradies vertrieben. Englische Piraten mit dem Freibeuter Henry Morgan an der Spitze verjagten sie und holten Jamaika ins Reich der britischen Krone. London bedankte sich mit einem Adelstitel für Morgan; außerdem wurde er zum Gouverneur von Jamaika ernannt. Die englische Herrschaft, die bis 1962 anhielt, übernahm das spanische Erbe. Sklaven wurden in zunehmendem Maße auch nach Mittel- und Nordamerika verkauft – Jamaika stieg auf zu einem bedeutenden Umschlagplatz im internationalen Sklavenhandel. Schätzungen besagen, daß in vier Jahrhunderten rund 1 Million Menschen als Sklaven aus Afrika nach Jamaika transportiert wurden. Etwa ein Viertel davon verblieb auf der Insel.
Auf den Zuckerrohrfeldern, auf denen die Sklaven arbeiteten, regierte die Peitsche der Aufseher ebenso wie auf den Schiffen, mit denen man sie übers Meer schaffte. Die Erinnerung an diese für uns kaum nachvollziehbare Erniedrigung lebte weiter, auch nachdem die Sklaverei in Jamaika im Jahrhundert offiziell abgeschafft worden war. „Everytime I hear the crack of the whip/ My blood runs cold/ I do remember on a slave ship/ How they brutalized my very soul…“ singt Bob Marley in seinem Song „Slave Driver“. Marley ist ein Mischling. Seine Mutter, Cedella Booker, stammt von afrikanischen Sklaven ab. Sein Vater, Norvan Marley, diente in der britischen Kolonialarmee.
Der Reggae hat eine ähnliche Vorgeschichte wie der Blues. Die Sklaven, die zur Arbeit auf amerikanischen Baumwollplantagen in den heutigen Süden ¿ der USA verfrachtet wurden, konnten ihre aus Afrika mitgebrachte Musikkultur nicht rein erhalten – als unterdrückte, rechtlose Arbeitstiere mußten sie zwangsläufig kulturelle Ausdrucksformen ihrer Unterdrücker übernehmen. Durch diesen Zusammenprall afrikanischer und europäischer Musik entstand der Blues.
Auf Jamaika lief auch so ein Prozess ab. Musik war ohnehin so ziemlich das einzige, was den Sklaven außer Arbeiten und Schlafen noch zum Leben blieb und die Erinnerung an die ursprüngliche Heimat wachhielt, aus der man verschleppt worden war. Westafrika besaß schon vor Jahrhunderten eine reichhaltige Musikkultur, die sich vor allem durch ihre rhythmische Vielfalt auszeichnete und die ausgesprochen körperbetont war. Sie eröffnete dem Trommler, Sänger oder Tänzer die Freiheit, sich auszuleben bis zur Ekstase, und sie stand damit im krassen Gegensatz zur europäischen Musik, die in starre, unveränderliche Formen gegossen war und die festgemauerten hierarchischen Strukturen der Feudalgesellschaft widerspiegelte.
Immerhin gab es in Europa nicht nur die Marschmusik der Millitärs und die Opern und Klaviersonaten der feinen Leute; dort, wo die einfachen Leute Musik machten, entwickelte sich auch eine weitaus lebendigere Folklore. Auf Jamaika wurden die Sklaven von der afrikanischen Westküste speziell mit der englischen Folklore konfrontiert; andere Einflüsse – etwa spanische Folklore und Kirchengesänge – kamen hinzu und sorgten für eine neue, reichhaltige farbige Volksmusik – die Folklore der Karibik. Musik machen durften die schwarzen Arbeiter an einigen wenigen Feiertagen im Jahr sowie immer dann, wenn die weißen Plantagenbesitzer Partys gaben und Unterhaltung brauchten. Dies war die Gelegenheit, neue Lieder zu entwickeln und mit einfachen Instrumenten wie Trommeln, Rasseln oder Bambusflöten zu experimentieren.
In den Texten der karibischen Sklaven war überraschend oft die Rede von Aufruhr und Zerstörung; ein Zeichen dafür, daß Sklaventreiber und Plantagenbesitzer den schwarzen Arbeitern zwar ein elendes Leben bescherten, aber nicht ihren Stolz und ihren Lebenswillen brechen konnten. Der Blues in Nordamerika hatte demgegenüber eine andere Grundstimmung; hier überwog die Trauer, und Klartext konnten die Afro-Amerikaner auch nicht reden – sie mußten, um ihr Leben nicht aufs Spiel zu setzen, zu unverdächtigen Bibelversen greifen und vom Land jenseits des Jordan singen, wenn sie ihren Brüdern und Schwestern etwas von der Freiheit jenseits des Missisippi mitteilen wollten.
Diese Unterschiede sind auch heute noch spürbar. Der Blues hat nach wie vor eine klagende Grundstimmung, ist eben „blue“; der Reggae wirkt demgegenüber positiv gepolt und lebensbejahend und verbreitet „positive vibrations“, auch wenn er von Slums und Sklaverei berichtet.
Die erste Spielart karibischer Folklore, die in Europa und gerade auch in Deutschland populär wurde, verriet ihren Hörern allerdings noch nichts über ihre erschreckende Herkunft. Denn wer in den fünfziger Jahren Calypso von Harry Belafonte hörte, dachte an die goldgelben Strände und die sich wiegenden Palmen der Karibik, sowie an Abenteuer mit goldbraunen Mädchen. Natürlich stimmt dieses Bild auch für Jamaika, speziell für die wunderschöne Nordküste; aber sie ist eben die Fassade, und auf der anderen Seite der Insel, dort, wo Kingston liegt, sieht Jamaika seit Jahrzehnten schon ganz anders aus.
Seit dem Ende der Sklaverei vor rund 150 Jahren hat sich die schwarze und weiße Bevölkerung vermischt. Einwanderer kamen hinzu – Chinesen etwa und Juden. Die soziale Schichtung indes veränderte sich nur unwesentlich; auch heute noch sitzt eine dünne weiße Oberschicht, angereichert mit wenigen farbigen „Aufsteigern“, an den Hebeln der Macht. Obwohl Jamaika längst nicht mehr so vom Zuckerrohr abhängt wie früher und inzwischen auch in bedeutenden Mengen Bauxit, Bananen und Tabak exportiert und zahlungskräftige Touristen ins Land holt, sind die underdogs die underdogs geblieben. Zwar hat sich eine kleine Mittelschicht gebildet (Kaufleute, Handwerker usw.), aber der soziale Aufstieg ist unendlich schwer.
Das große Geld haben in Jamaika in diesem Jahrhundert ausländische Firmen gemacht, und seit der Unabhängigkeit hat sich daran nicht viel geändert. Der gemäßigt sozialistischen Regierung unter Premier Michael Manley fehlt das Kapital, um das Land fest auf eigene Füße zu stellen; jenes Kapital, das wohlverwahrt in ausländischen Tresoren liegt. Derzeit macht in Jamaika ein neuer Regierungsslogan die Runde – „Build Jamaica with discipline“, aber wie soll man Disziplin beim Aufbau halten, wenn man nichts zum Aufbauen hat? Die Hauptstadt Kingston zieht Jamaikas übrige Bevölkerung seit Jahrzehnten magisch an; die Landflucht hat das Landesinnere stark entvölkert und einen Kranz von Gettos beschert, in denen Arbeitslosigkeit und Aggressivität nit sten. Aber: auch die Musik ist hier zuhause. Nur: Calypso ist nicht mehr angebracht, obwohl Elemente von ihm auch in die Gettomusik eingegangen sind.
In den fünfziger und frühen sechziger Jahren stand in Kingston vor allem schwarze Musik aus den USA hoch im Kurs, die über Radiowellen und durch direkte Kontakte herüberdrang. Ryhthm & Blues und Soul als direkte Nachfahren des Blues wurden in den Blechhütten, Bretterbuden und angeknacksten Steinhäusern der ärmeren Viertel von Kingston akzeptiert. Wichtig waren voi allem der Beat, der es möglich machte, zu tanzen und aus dem Dreck des Alltags auszuflippen, und die Baßünie, die sich pulsierend in den Unterleib drängte und an die Freuden des Lebens erinnerte.
Eines Tages wurde in Kingston eine bedeutsame Erfindung gemacht: Irgendjemand packte zwei dicke Boxen mit guten Baßlautsprechern, einen wackeligen Plattenspieler, einen zerschrammten Verstärker und einen Haufen Singles zusammen und zog durch die Stadt, um in Rumbars und zwischen verfallenden Häuserzeilen Station zu machen und die Leute mit Konservenmusik zur Ekstase zu treiben. Die Bässe wurden voll aufgedreht und die Leute tanzten und hatten ihren Spaß. Das Rezept war so vortrefflich, daß die Nachahmer bald kaum noch zu zählen waren. Diese „Sound-System-Men“ kamen bald auf die Idee, sich gegenseitig mit Platten auszustechen, die auf irgendeine dubiose Weise in Jamaika selbst aufgenommen wurden, volksnäher waren, und bei der Bevölkerung großen Anklang fanden. Und weil der Hunger der Sound-Systems immer größer wurde, kam das Musikbusiness in Jamaika auf Touren. Primitiv eingerichtete Studios und winzige Plattenfirmen entstanden, und Jungs von dei Straße konnten plötzlich einen lokalen Hit landen und damit ein paar Dollar verdienen.
Los ging das alles noch in den fünfziger Jahren, und wie es dann lief, zeigt der Film „The Harder They Come“ mit Jimmy Cliff in der Hauptrolle. Jimmy spielt einen rude boy, einen arbeitslosen jungen Typ mit Hunger und Zorn im Bauch. Er singt bei den Label und Studiobesitzern vor, um ihnen am Ende die Rechte an seinem Song und seinem Gesang für zwanzig Dollar zu verkaufen. Später hört er sich dann im Radio und weiß, daß er einen Hit geschafft hat und jemand anders damit Kohle macht.
Als Jamaika begann, eigene Platten zu produzieren, verlor die schwarze Musik aus Amerika schnell ihre dominierende Stellung. Aber sie bildete zugleich ein wesentliches Element der neuen Musik der Insel, die außerdem in der karibischen Folklore wurzelte: Die Jungs in Kingston hatten sich endgültig auf ihr eigenes musikalisches Erbe gestürzt. In den sechziger Jahren gab es verschiedene Namen für einzelne Entwicklungsstufen dieser Musik: Ska (in England Blue Beat genannt) und Rock Steady. Ende der sechziger Jahre war sie dann ausgereift und wurde Reggae genannt nach einem Song von Toots und den Maytals: „To The Reggay“.
Der Reggae-Rythmus ist regelmäßig, im Gegensatz zum unregelmäßigen Calypso. Er wirkt zunächst monoton, entfaltet aber rasch durch die Wiederholungen eine hypnotische Wirkung. Er ist vor allem Körpermusik, sinnliche Musik – intellektuelle Ansprüche befriedigen die Texte, die Bob Marley und andere herausragende Gettosänger verfaßt haben. Die Melodien beim Reggae sind einfach und eingängig gehalten und überraschen oft durch ihre harmonische Schönheit. Eine wichtige Rolle spielen zudem die Bläser, die schon beim Ska auf den Offbeat ein Riff setzten und so ein charakteristisches Soundelement schufen, das den Hörer in Verbindung mit dem Rhythmus endgültig zwingt, sich zu bewegen, zu tanzen.
Geprägt wird der Reggae in starkem Maße allerdings noch von einem außermusikalischen Phänomen: den Vorstellungen einer religiösen Sekte, deren Mitglieder ihre Haare au eigenwilligen Zöpfen, den Dreadlocks, drehen; die Ganja, das Marihuana Jamaikas rauchen; die Rastafari oder kurz Rastas genannt werden. Die Rastas stehen in ihrer Heimat in hohem Ansehen. Einmal, weil kleinere Gruppen von ihnen („Maroons“) unabhängig von jeglicher Regierungsgewalt in den vom Dschungel überzogenen Bergen im Innern Jamaikas leben; sie sind Nachkommen von entlaufenen Sklaven, die in den Jahrhunderten der Kolonialherrschaft niemals (!) unterworfen wurden. Zum anderen, weil sie mit ihrer „Back to africa“ Ideologie dem versklavten, entwurzelten Volk Jamaikas den Weg in eine eigene Identität weisen.
Die Bewegung der Rastas erstarkte, als in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts in Jamaika der Ruf nach Unabhängigkeit erstmals vernehmlich zu hören war. Der große Lehrer und Prophet der Rastas war Marcus Garvey, der in jener Zeit selbst in den USA unter den Schwarzen zahlreiche Anhänger sammelte. Marcus Garvey rief seine Jünger auf, in ihre eigentliche Heimat zurückzukehren, nach Afrika. Er gründete für den Transport der Heimkehrer sogar eine eigene Schiffahrtslinie, die „Black Star Line“. Eines dieser Schiffe passiert man, wenn man heutzutage zum internationalen Flughafen von Kingston fährt. Es liegt gestrandet am Fuße einer flachen Sanddüne.
Marcus Garvey wagte vor fünfzig Jahren eine Prophezeiung: In Afrika werde man einen schwarzen König krönen, dessen Bestimmung es sei, die schwarzen Amerikaner und Jamaikaner ins Land ihrer Herkunft zurückzuführen. Als 1930 Haue Selassi, genannt „Der Löwe von Juda“, zum Kaiser von Äthiopien gekürt wurde, erkannten ihn die Rastafari als Gott an und nannten ihn Jah. Und dabei blieb es, obwohl Haue Selassi in seinem Leben wenig getan hat, um die Prophezeiungen des Marcus Garvey zu erfüllen. Immerhin, der Kaiser kam einmal zum Staatsbesuch nach Jamaika. Und im übrigen, versichert man auf der Insel, ist Selassie der Gott etwas ganz anderes als Selassie der Mensch.
Die meisten wichtigen Reggae-Musiker gehören zu den Rastafari. Und wenn sie in einem Konzert in Jamaika „Jah“ in die Menge rufen und die Menge mit „Ras Tafari“ antwortet, dann geschieht dies mit religiöser Inbrunst. In Europa dagegen sind solche Shouts ein Ritual, zu dem die Rock- und Reggae-Fans keine echte Beziehung haben. Eine andere „Erfindung“ der Rastas aber macht hierzulande schon seit zehn Jahren die Runde: der Slogan „Love and peace“. Amerikanische Hippie-Gruppen, die in den sechziger Jahren an der Nordküste Jamaikas lebten, brachten ihn mit nach Kalifornien, wo er Karriere machte als Aushängeschild der Flower-Power-Bewegung.
Die Rastas wollen mit „Love and peace“ indes nur sagen, daß sie friedliche Leute sind und erwarten, daß niemand mit ihnen Streit anfängt, weil sie ja auch keinen Streit wollen. Obwohl man von ehemaligen unterdrückten Sklaven soviel Friedfertigkeit eigentlich gar nicht erwartet, sah der Arm des Gesetzes auf Jamaika bei solchen Sprüchen lange Zeit rot. Die Rastas wurden verhaftet, auch weil sie illegal Ganja rauchten, und in Lager und Gefängnisse gesperrt; die Haare schnitt man ihnen ab. Also begannen sie, ihre Haare unter großen Mützen zu verstecken. Wenn heute in einem Konzert der Reggae-Sänger plötzlich die Mütze vom Kopf reißt und wild die Dreadlocks schüttelt, so steckt also mehr dahinter als nur Show.
Erst die letzten Jahre brachten den Rastas mit der wachsenden Weltgeltung des Reggae mehr Freiraum. Aber ein Mann wie Peter Tosh, der in den Straßen von Kingston unermüdlich seinen Kampf für soziale Gerechtigkeit und für die Freigabe von Ganja führt, hat immer noch reichlich Ärger mit der Polizei und sieht sein Blut fließen. Kingston mit seinen Gettos ist ein Pulverfaß trotz all der positive vibrations; und die Bullen fackeln nicht lange.
Was in Gettos wie Trenchtown und auf den Straßen in downtown Kingston los ist, hat Bob Marley in vielen Songs beschrieben. „Them belly full but we hungry/ A hungry mob is an angry mob“ heißt es da und: „Get up, stand up/ Stand up for your rights!“ Klage, Warnung und Anstiftung zur Rebellion von einem Mann, den ein religiöser Glaube motiviert, der zwar im Christentum – oder besser: in der Bekehrung durch eine europäische Kolonialmacht – wurzelt, aber weitaus näher an der Wirklichkeit und am Alltag der Gläubigen liegt als die von der evangelischen oder katholischen Kirche in Europa gepflegten Spielarten des Christentums.
Auf fruchtbaren Boden fielen solche Lieder von Marley und anderen Reggae-Interpreten zuerst in England, wo mittlerweile allein in London 500.000 Einwanderer aus der Karibik leben und wo schon vor einem Jahrzehnt Reggae-Nummern von Jimmy Cliff oder John Holt die Hitparaden bevölkerten. Von dort aus griff das Reggae-Fieber auf Kontinentaleuropa und die USA über – weil auch immer mehr weiße Jugendliche begriffen, daß Marley, der Rebell aus der Dritten Welt, ihnen etwas zu sagen hatte. Über geschichtliche Vergangenheit und Gegenwart, über Unrecht und Unfreiheit. Über eine bessere Art zu denken und zu leben. Vorangetrieben vom Rhythmus des Reggae, von seiner Sinnlichkeit und Lebensfreude. Reggae wurde damit auch Rock. Und Marley ist wohl der wichtigste Rockinterpret, den die siebziger Jahre bislang hervorgebracht haben. Niemand hat solch ein Charisma, niemand hat solche Songs geschrieben, niemand hat soviel Neues mitgebracht.
Bob Marley hat für uns den Vorhang aufgerissen, der die Musikszene auf Jamaika verhüllte. Und diese Szene ist in jüngster Zeit geradezu vor Kreativität explodiert. Da gibt es die Studios, die mit den Elektronik-Salons in New York oder Los Angeles nicht Schritt halten können, in denen aber eine so ungewöhnliche und belebende Atmosphäre herrscht und die über so großartige Studiomusiker verfügen, daß immer mehr Rockstars nach Kingston pilgern. In den Dynamic Sound Studios zum Beispiel nahmen bereits Paul Simon, die Rolling Stones und Cat Stevens Platten auf.
Da gibt es außerdem die Produzenten, mit Lee Perry, genannt „Scratch“ oder „The Upsetter“ an der Spitze. Perry ist ein kleiner, humorvoller Rasta mit wachen, flinken Augen. Seine Hauswände ließ er mit religiösen Motiven sowie einem Abbild vom Cover seiner LP „Superape“ bemalen. Sein Studio sieht aus wie der elektronische Hobbyraum eines deutschen Oberschülers. Aber wenn dieser Mann seinen Studiomusikern aas Zeichen gibt, den Reggae-Beat loszulassen, und wenn er dann hinter dem Mischpult anlangt, zu tanzen und dabei dennoch konzentriert eine Platte produziert, dann haben renommierte Rockstudios wie Wally Heider oder Caribou oder Abbey Road schon verloren. Bob Marley ließ seine frühen Aufnahmen sowie den einen oder anderen Song seiner berühmten späteren Alben von Lee Perry produzieren.
Soundhexer wie der Upsetter sind zudem Schöpfer einer Spielart des Reggae, tüi die es in der Welt keine Parallele gibt: Dub. Bereits fertige Reggae-Songs oft bereits Hits – werden neu abgemischt und dabei kunstvoll verändert. Der Gesang wird in der Regel herausgemischt; dafür spielt der Hall und Mehrfachhall eine große Rolle, entstehen neue Breaks, wird die Gewichtung der einzelnen Instrumente zueinander höchst gewitzt verändert. Zwei LP-Paare bieten sich besonders an, um die Dub-Kunst zu studieren: „Planet Earth“ (Original) und „Planet Mars Dub“ von den Diamonds und „Marcus Garvey“ (Original) und „Garvey’s Ghost“ (Dub) von Burning Spear.
Dann sind da noch die Toaster oder DJ’s; Nachfahren der Sound-System-Men. Sie kamen zunächst auf die Idee, in die Schallplatten, die sie abspielten, hineinzusprechen und passend zum Rhythmus Sprüche zu machen. Später entwickelte sich daraus eine eigenständige Reggae-Form, und der Sprechgesang der DJ’s mit ihren meist witzigen Namen hat selbst in Europa Einzug in die Hitparaden gehalten. Wichtige Vertreter dieser Richtung: Dillinger, Big Youth, U-Roy, I-Roy, Prince Far-I.
Hörenswert sind auch die Roots-Rocker, die bei uns noch keinen großen Namen haben: Jacob Miller zum Beispiel, Delroy Washington, die Band We The People und das Gesangstrio Culture.
In England begründen gerade die Kinder eingewanderter Jamaikaner eine eigene Reggae-Tradition (Steel Pulse, Poet And The Roots). In Jamaika ist noch immer der verstorbene Count Ossie unvergessen, der mit der Mystic Revelation Of Rastafari Brücken schlug zwischen Reggae und sehr freiem Jazz.
Reggae meets Rock: aus diesem jungen Baum sprießen immer neue Äste. Third World, Inner Circle, Ijahman, Peter Tosh, Bunny Wailer (Tosh und Wailer, jetzt Solointerpreten, gehörten mit Marley zu den Gründungsmitgliedern der Wailers). „Reggae ist wie Wasser Mann. Du kannst ihn nicht stoppen!“
Über Reggae kann man eigentlich nur ein Buch oder eine fünfteilige Serie schreiben. In einer ME-Special Story, deren Umfang nicht beliebig erweitert werden kann, lassen sich viele Aspekte der Reggae-Musik nur anreißen oder müssen ganz entfallen. Wer also in diesem Heft zu wenig erfahren hat, muß noch etwas Geduld aufbringen. Der ME wird im Verlauf des Jahres 1979 noch einzelne Reggae-Interpreten näher vorstellen, eine eigene Special Story über Bob Marley veröffentlichen und die Querverbindungen zwischen Reggae und New Wave aufzeigen. It’s a punky reggae party….