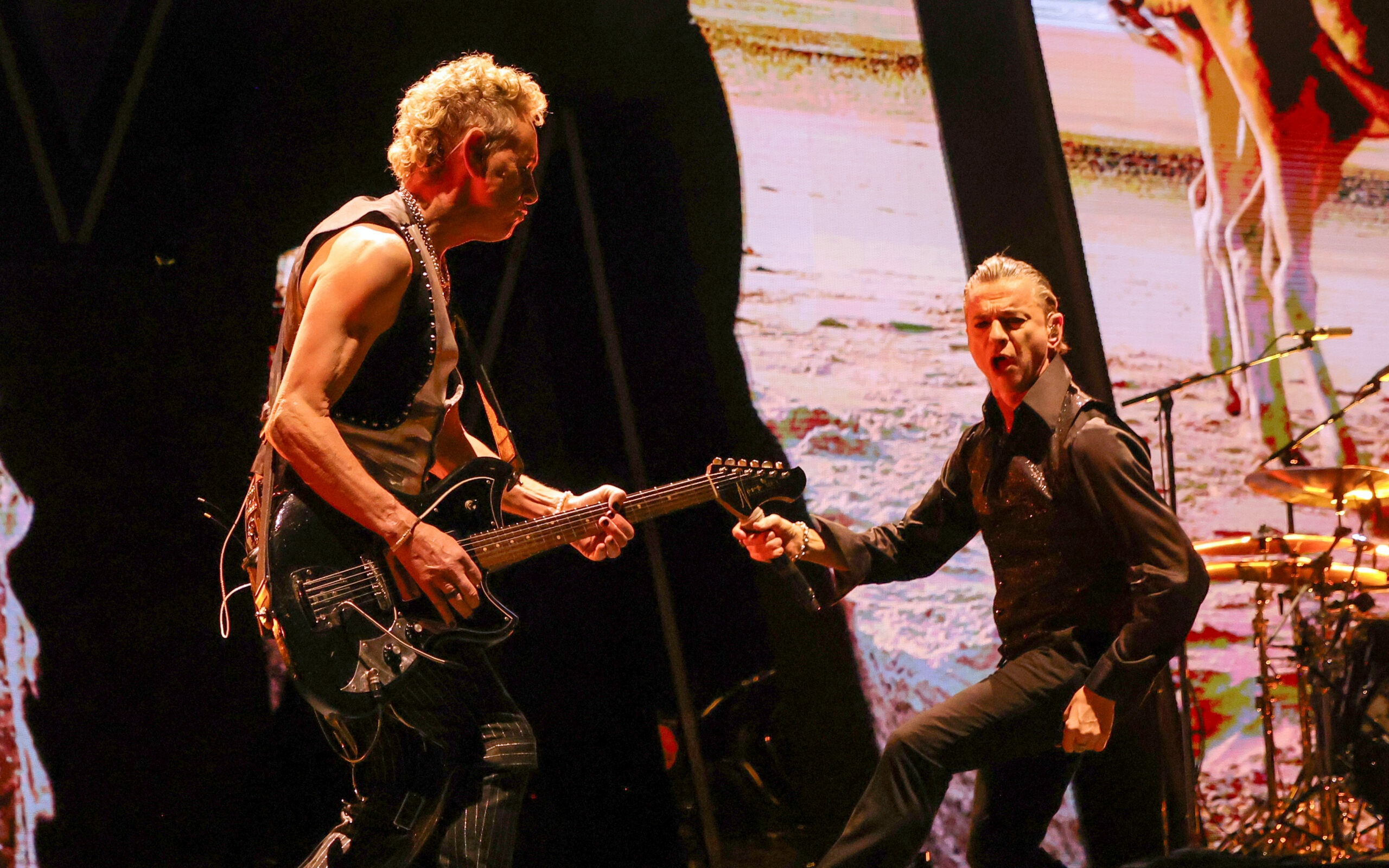Sinead O’Connor

Sie war für ihre Wut und verbale Aggression vor und hinter der Bühne berüchtigt. Jetzt verbergen sich diese Gefühle unter einer hellen Robe und spirituellem New-Age-Karma, Aber auf der Bühne brechen sie immer wieder hervor – das kreischende Nebelhorn ihrer Stimme in einem zerbrechlichen Love-Song, die geballte Faust am Ende von „Troy“, die radikalen Anti-Thatcher-Statements von „Black Boys On Mopeds“. Und genau das ist das Faszinierende und Brillante an Sinead O’Connor: diese Spannung zwischen Liebe und Haß, zwischen dem Bedürfnis, fürs Publikum zu singen, und dem Wunsch, nicht auf der Bühne stehen zu müssen – dieser gesunde Haß gegen die Fans.
Mit ihrem kurzgeschorenen Kopf sieht sie aus wie ein halbverhungerter buddhistischer Mönch. Oder wie eine Geistesgestörte – wie sie da nervös und zappelig mit den Händen gestikuliert. Manchmal singt sie alleine, begleitet sich mit einer zwölfsaitigen Gitarre, die zweimal so groß zu sein scheint wie sie selbst. Manchmal liefern zwei Synthesizer eine pseudo-traditionelle Begleitung mit dem Sound von irischen Flöten und Fiedeln. Manchmal (beispielsweise bei „Jump In The River“) steht eine vollzählige Rockband mit Baß, Gitarren und Drums mit auf der Bühne – das sind die enttäuschendsten Augenblicke des kurzen Sets.
Aber alleine ist Sinead O’Connor atemberaubend. Sie geht körperlich völlig auf in dem, was sie singt – in den sanften, sehnsuchtsvollen Liebesliedem scheint sie dahinzuschmelzen, so daß man sich unwillkürlich anstrengt, noch alle Details zu hören. Und wenn sie schreit, scheint ihr Körper buchstäblich von Gewalt geschüttelt.
Die traurige Ballade von „Jackie“ wartet mit einem seltsamen, kJeinen irischen Jig am Ende auf; „I Do Not Want What I Haven’t Got“ wirkt ruhig und bewegend wie ein Kindergebet. In der Mitte des Sets windet sich ihr drahtiger Körper zur Prince-Elegie „Nothing Compares 2 U“ in einem vor Gefühlen schmerzverzerrten Tanz. Da zittern selbst harte Männer im Publikum vor tiefer Rührung, denn auch ohne die berühmte Träne aus dem Videoclip ist das unglaublich intensiv. In Jerusalem“ und „Mandinka“ herrschen dann zum Ausgleich komische stimmliche Verzerrungen und ein kreiselnder Tanz der Arme vor, der aussieht, als schrubbe sie einen Elefanten-Hintern.
Trotz des heftigen Applauses gibt’s nur eine Zugabe: „Troy“ – eine karge Version, nur Sinead und die Gitarre, heulend vor Leidenschaft, stöhnend vor Schmerz. Sie verläßt die Bühne mit erhobener Faust und schreit die letzte Zeile des Songs in den Saal: „You’re still a fucking liar!“
In Interviews äußerte sie die Befürchtung, sie könne sich allmählich zum Hippie wandeln. Mit all der Wut und Rage, die noch immer hinter der neuen Sanftmut lauern, würde man sie nie in dieser dubiosen Clique dulden.