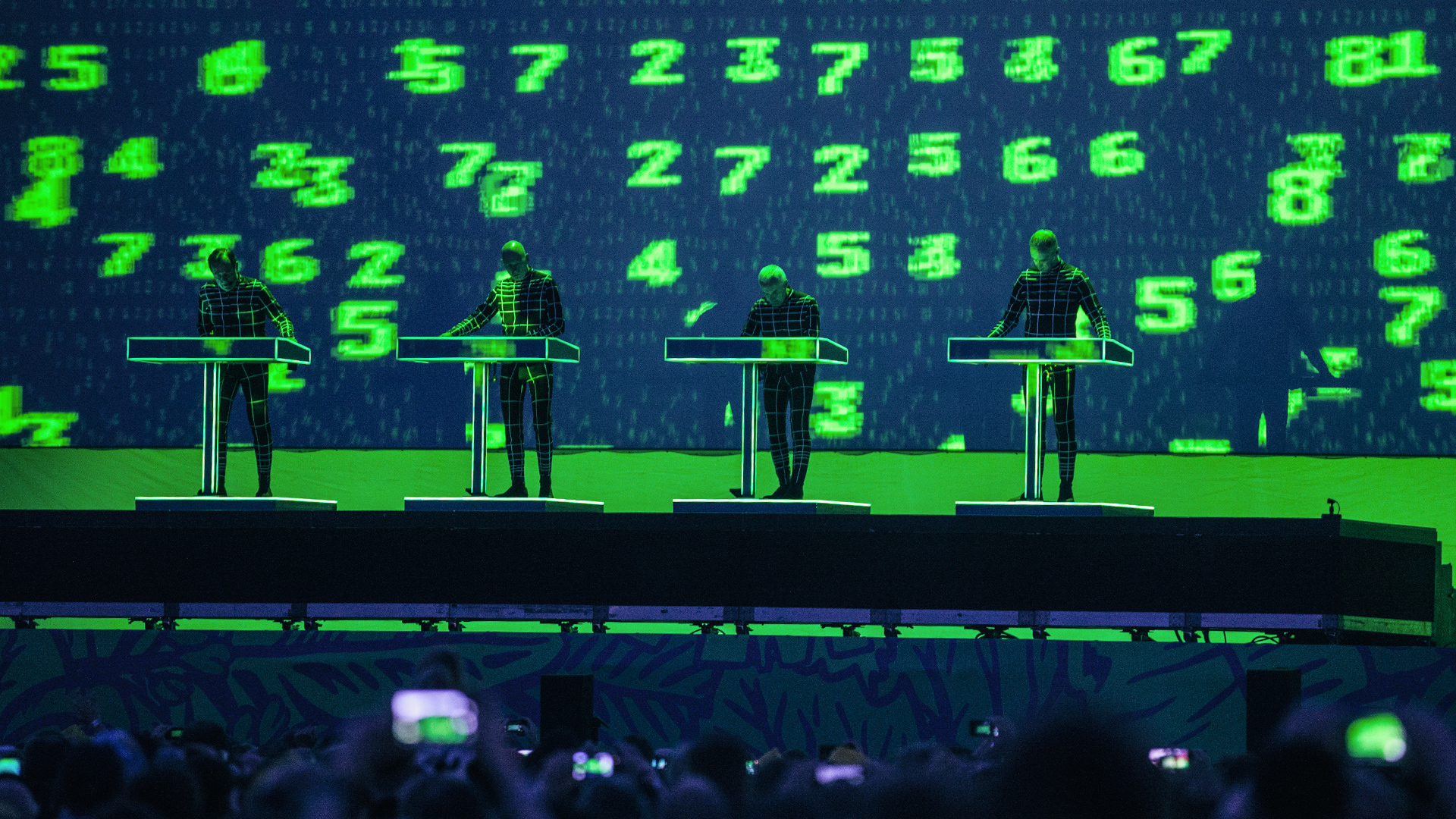Fliegende Nägel, harte Wahrheiten
Pete Doherty, da waren sich alle einig, ist so gut wie tot, Babyshambles erledigt. Dann aber ließ sich der vielleicht größte Rockpoet unserer Zeit von einem Freund de Leviten lesen, von einem Produzenten Grundregeln befehlen - und erwachte zu neuem Leben.

Da ist sie, die Ikone des britiscnen Pop-Hedonismus, sowie man sie kennt: torkelt an der Bar des „Boogaloo“ herum, schüttet sich Weißwein aus der Flasche in den Kopf, besabbert Anzug und Krawatte und lallt sinnloses Zeug. Der Mann ist fesch gekleidet, aber ein Wrack, nicht vorzeigbar, ein bleiches, ausgezehrtes Gerippe. Fassungslos schaut die Menge in der ausverkauften Halle zu, wie er während der neuen Single langsam vom Hocker taumelt, ein paar Schritte nach rechts stolpert, gegen einen langen Kerl mit Schnurrbart kippt und das Bewusstsein verliert. „Der ist hinüber“, wird geflüstert. „Ist das peinlich.“ „Wie traurig ist das denn?“
Während bei „Delivery“ alle Blicke auf den an der Bar in Ohnmacht fallenden Shane MacGowan gerichtet sind, ist Pete Doherty auf der winzigen Bühne des „Boogaloo“ in blendender Verfassung: fröhlich, nüchtern, den ganzen Abend lang kaum ein Krächzen oder Kratzen in der Stimme. Voll konzentriert auf jedes Zupfen und jeden Akkord, spielt er den klarsten und mitreißendsten Babyshambles-Gig seit Menschengedenken, obwohl ihm immer mal wieder eine seiner vielen Hals-, Arm- und Uhrketten in die Saiten gerät. Die Band, einst eine amateurhafte, chaotische Kneipencombo, ist tight und professionell wie eine Formationsflugstaffel und, modisch betrachtet, fit für den Laufsteg – Adam und Mik haben sich in schicken Mod-Zwirn geworfen, Drew kommt in vollem Leichenbestatter-Gehrock auf die Bühne. Die Songs, ansonsten oft ein matschiges Gefummel, strahlen wie Diamanten. Hingebungsvoll lauscht das Publikum (darunter Petes alter Kumpel Wolfman und Produzent Stephen Street) den neuen Nummern von einem Album, mit dem Pete nicht nur zu alter Stärke zurückgefunden, sondern seine beste Platte seit Up The Bracket abgeliefert hat. Wir sind, sagen wir es deutlich, Zeugen einer Auferstehung.
Die Boulevard-Schmierfinken, die sich hinten beim Ausgang versammelt haben, werden freilich eine ganz andere Geschichte erzählen, ihn als tragische Figur darstellen, zerrüttet und endgültig gebrochen seit der Trennung von Kate Moss vor ein paar Tagen. Sie werden schreiben, der Auftritt sei chaotisch und wirr gewesen, und über Schnappschüsse geifern, die Pete als abgehärmten und fertigen Schürzenjäger zeigen. Seine Musik kümmert sie einen Dreck, sie brauchen einfach ein Schlusskapitel für die größte Prominenten-Soap-Opera der letzten zehn Jahre, wahr oder nicht. Die Wahrheit ist jedoch wesentlich spannender. Nur ein Trottel würde Doherty ohne eingehende medizinische Untersuchungen für clean und drogenfrei erklären, aber er ist eindeutig auf dem richtigen Weg – seine letzten Auseinandersetzungen mit der Polizei waren (vergleichsweise) Kinkerlitzchen, und seit der Absage der halben Arenatournee letztes Weihnachten hat er es geschafft, zu sämtlichen Gigs zu erscheinen (meistens pünktlich) und zu spielen und damit nicht nur seine Kritiker zu verblüffen. So ist ironischenveise ausgerechnet jetzt, wo der Heißhunger der Schlagzeilenmacher einen neuen Höhepunkt erreicht, der richtige Zeitpunkt, das Klatschgeplapper mal auszublenden und sich auf die Musik hinter dem Mythos zu konzentrieren. Sich mit Doherty, dem Wiedergeborenen, zu befassen.
Ein paar Stunden zuvor. „Die Sache mit Down In Albion ist die“, sagt ein strahlender, freundlicher und aufgeweckter Pete, der in Shane MacGowans Wohnzimmer über dem „Boogaloo“ sitzt (zufällig demselben Raum, wohin sich Pete und Carl Barât bei ihrem ersten Nach-Libertines-Treffen letztes Jahr zum Plaudern zurückgezogen haben) und an einer Plastiktüte herumfummelt. „Es fängt richtig gut an, wird dann aber irgendwie zu einer anderen Platte. Sie bringt sich sozusagen selbst durcheinander, weil sie an allen möglichen unterschiedlichen Punkten aufgenommen wurde und immer wieder Leute gekommen und gegangen sind. Es gab eine Phase, in der Pat in drei Monaten ein einziges Mal im Studio aufgetaucht ist. Sein Vater starb während der Aufnahmen, und es gab alle möglichen anderen Tragödien wid Komödien. Diesmal ist alles relativ schnell gegangen, und wir haben den Nagel auf den Kopf getroffen, bei Down In Albion hingegen sind jede Menge Nägel in der Gegend herumgeflogen, und meine Hände waren in viel schlechterer Verfassung.“
Er zupft an dem Pflaster an seiner linken Hand – Folge einer unsanften Begegnung mit einer Autotür -, betrachtet ein Filmplakat für „The Great Gatsby“ von 1974, das an der Wand hängt. „Außerdem war damals meine Stimme komplett im Eimer. Sechs Monate lang konnte ich nicht mal sprechen, und irgendwie hab ich’s gerade so geschafft, ein paar halbwegs anständige Takes auf Band zu bringen. Diesmal war ich in der Lage, zu singen, und insgesamt wurde ein bisschen mehr Selbstkontrolle praktiziert. Wir haben sogar während der Studioarbeit eine Fußballmannschaft zusammengekriegt und ein Sechserturnier gewonnen. Razorlight haben uns geschlagen, stimmt, aber das war ganz am Anfang, in der Qualifikation, und die haben dann gegen Eton Road verloren, und wir haben am Ende gesiegt … ah, Revanche! Den Pokal haben wir aufs Mischpult gestellt. In Augenblicken des Zweifels und der Unreinheit griffen wir nach der Trophäe und fühlten Erlösung…“
Nach Jahren des drogendurchseuchten Wahnsinns – als Absagen, Auftritte bei annähernder Bewusstlosigkeit, Verhaftungen, Entzugsversuche, desertierende Schlagzeuger und prominente Freundinnen die Musik überschatteten – ist es eine Erleichterung und ein Triumph, dass sich Babyshambles endlich doch als Sieger fühlen dürfen. Auf der langen, harten Reise haben sie gelernt, richtig zu spielen und sich durchzusetzen, und mit dem neuen Gitarristen Mik Whitnall (Ex-Kill-City, heißt eigentlich Mick, hat das c aber gestrichen, damit der Name „sowjetischer“ wirkt) anstelle von Petes früherem Songwriting-Partner Patrick Walden ist ihnen mit dem zweiten Album ein kleines Meisterwerk gelungen – eine lebendige und stimmige Sammlung von kraftvollen, prägnanten Popsongs, die weder in ausgedehnte Ska-Jams noch in Junkiegebrabbel abdriften. In striktem Widerspruch zu Regel Nummer eins der Rock-und-Drogen-Physik -jedes Körnchen Betäubungsmittel, dass du dir zuführst, steht in direkter Proportionalität zu deiner kulturellen Bedeutung – haben Babyshambles alle Erwartungen bei Weitem übertroffen, Down In Albion war eine Handvoll klassischer Songs, gemischt mit Aufnahmen, die im Wesentlichen aus Sitzungen mit der Crackpfeife bestanden, während das Band weiterlief, dieses Album hingegen ist das Werk von Musikern, die wild entschlossen sind, die beste Platte zu machen, die sie machen können.
„Ich bin so Stolz darauf“, grinst Pete. „Es ist traurig, wie schwer es mir immer gefallen ist, Platten aufzulegen, die ich gemacht habe. Aber diesmal ist das ganz natürlich: Wir haben eine Platte gemacht – hören wir sie uns an und genießen wir sie! Ich hab so das Gefühl, dass ich in der Vergangenheit einige Sachen ausgelassen und verpasst habe, weil andere Dinge wichtig erschienen als die Frage „Taugt es was?‘ Diesmal ist’s ein echter Volltreffer zehn von zehn Punkten!“
Ein großer Teil von Petes nüchterner musikalischer Besonnenheit ist Mik Whitnall zu verdanken, einem engen Freund der Band, der die Leadgitarre übernahm, als das Zerwürfnis zwischen Pete und Patrick nicht mehr zu kitten war. Sein scharfer, fokussierter Pop-Intellekt, sein Gespür und seine puristische Begeisterung für Ska und Reggae halfen, einige von Petes planloseren Songs auf den Punkt zu bringen. Außerdem konfrontierte erden Freund mit einer happigen Ladung harter Wahrheiten.
„Vor etwa einem Jahr hatten wir einen ziemlichen Durchhänger“, erinnert sich Mik. „Ich weiß nicht, ob es Pete gefällt, dass ich dir das erzähle, aber ich hab zu ihm gesagt: Wenn du so weitermachst, wirst du sterben. Ich sagte: Warum Zossen wir den ganzen Scheiß nicht sein und kümmern uns um das, wofür wir auf der Welt sind: um verdammt noch mal ein paar gute Lieder zu schreiben? Ich könnte es nicht ertragen, wenn Pete nur als Freund von Kate Moss in Erinnerung bleibt, als Andrew Ridgley des Punk. Die ganze Presse hat letztes Jahr erwartet, dass er stirbt Ich möchte einfach, dass man sich an ihn als brillanten Musiker erinnert, und ich glaube nicht, dass er seine besten Sachen schon gemacht hat. Er ist 28 und ein großartiger Musiker, also habe ich ihm einen ‚Krempel die Ärmel hoch!‘-Vortrag gehalten.“
Und dann war da noch die eiserne Faust am Mischpult – Produzent Stephen Street, der mit Blur im Studio gearbeitet hat, während der große Britpop-Kokain-Monsun durchs Land fegte, und daher sehr genau weiß, wie man durchgehende Egos an die Kandare nimmt; der vielleicht einzige geeignete Mann für den härtesten Job im Rockgeschäft: einen nüchternen Pete Doherty dazu zu bringen, Musik aufzunehmen.
„Ich denke, es hat funktioniert“, sinniert Pete. „Wir haben uns kurz vor den Aufnahmen getroffen, und ich sagte: Wir verlassen uns darauf, dass du uns ein Album produzierst. Wir haben ein paar Songs beisammen, sind aber nicht sicher, ob wir“s draufhaben, sie richtig und pünktlich und gut hinzukriegen. Und er sah mir in die Augen und sagte, er könne das machen, dazu müssten aber ein paar Grundregeln festgelegt werden. Die erste Woche war mehr so ein Abtasten, ergab ein bisschen den Wüterich, alles ging schleppend, viele Abfalleimer wurden durch die Gegend getreten, und fast wäre alles ziemlich schiefgegangen. Aber dann waren die Grundregeln endgültig festgeschrieben, und es ging aufwärts. Von da an war alles in Ordnung.“ – „Er hat eine sehr disziplinierte Arbeitsweise“, fügt Drew hinzu. „Das ist total anders als bei Mick Jones. Es war auch eine Freude, mit Mich Jones zu arbeiten; beide sind auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen Gründen Helden der Band. Mit Stephen zu arbeiten, war ein stabilisierendes Element, das zu der Zeit dringend nötig war. Wir hatten unzählige Songs, die fertig oder zu drei Vierteln fertig oder nur unausgegorene Ideen waren,und Stephen hat uns geholfen, die losen Enden zu verknüpfen.“
Es ist ein meisterlicher Knoten, den sie da geknüpft haben, und wie immer enthüllt und erhellt er manches Intime. So wie The Libertines das wunde Herz der gebrochenen Beziehung von Pete und Carl offenlegte und „Pipedown“ auf Down In Albion ein Hinweis auf die wirklichen Gründe für Patrick Waldons Ausstieg ist („Paddy, leg die Pfeife weg“, o ja!), so ist dieses Album fast eine Art Bandgeschichte zum Hören, bevölkert von den Leuten aus ihrem Umfeld, mit Abstechern zu den Orten, die sie geprägt haben, und Gedanken über und schlichten Hymnen auf den wilden Zirkus, der sich unablässig um sie dreht. In den dunkleren, persönlicheren Songs sind die Tatsachen von raffinierten Anspielungen verschleiert – wir können nur spekulieren, wer das Mädchen in „Baddies Boogie“ ist, das „viel zu gut aussieht, um selbst zu kochen“, und was Pete wohl meint, wenn er in „The Lost Art Of Murder“ singt „Get off your back / Stop smoking that“ aber mit Sicherheit beginnt das Album in einem schäbigen besetzten Haus in Hackney, wo Drogen mit der Morgendämmerung kollidieren.
„‚Carry On Up The Morning‘ ist, schätze ich, einer dieser langen, verlorenen Tage zu Laburnum-Street-Zeiten (Petes altem Revier) in Hackney“, erklärt Pete, „wenn der Morgen die Nacht ablöst und die Tage von den Nächten abgelöst werden. Und die ganze Zeit taucht immer wieder diese Melodie auf. ‚Delivery‘ ist auch so ein verlorener Morgen in einer anderen Ecke von Hackney. Das ist einer von den Songs, wo wir uns hingesetzt und gesagt haben, wir wollen einen Song machen, der genau so klingt. Na ja, ist ja klar, nach was er klingt; wir haben entschieden, dass das (er spielt „All Day And All Of The Night“ von den Kinks auf der Gitarre) unser liebster Rhythmus überhaupt ist und dass wir so was wie das machen. Der Song richtet sich an einen Burschen, der in einer Brauerei rumhängt und wieder und wieder von seinem Boss zusammengeschissen wird, weil er nicht da war, als die Bierkisten angeliefert worden sind, und am Wochenende zieht er sein Fred-Perry-Hemd an und zieht um die Häuser und knallt sich zu und reifst ein Mädel auf, und dann am Montag geht alles von vorne los. Das war auch einer der ersten Arbeitstitel für das Album.“ Es geht also darum, der Tretmühle von Alltag und Lohnarbeit zu entfliehen. Pete nickt, „Ja, der Song ist wohl so eine Art fliegender Teppich mit vielen Fässern Bier drauf.“
Es gibt auch jede Menge Stoff für Doherty-Besessene, um sich den Kopf zu zerbrechen und Blogs zu füllen. „French Dog Blues“, liebe Pete-Trivia-Fanatiker, handelt von seinem Hund, der als Zeichnung das Cover von Down In Albion zierte und auch auf Shotter’s Nation zu sehen ist, „wenn man genau hinschaut. Er ist der unsterbliche Charakter, oder sagen wir: die Figur der Unvergänglichkeit“, sagt Pete. „Er taucht überall in London auf, du siehst ihn auf U-Bahn-Zügen und den Einkaufstaschen alter Damen. Viele Kids haben Tätowierungen mit dem French Dog.“
In dem täuschend süßlichen, fast (!) kitschigen „Unbilotitled“ (noch so eine verlorene Nacht mit Pete, Wolfman und Mik, hier unter dem Spitznamen Blue Eyes, mit der merkwürdigen Textzeile „Wolfman said to Blue Eyes: ‚Put your trousers back on'“, hinter der sich vermutlich eine lange Geschichte verbirgt) und „Unstookietitled“ (über das Pete sagt, es sei „die Placenta von ‚Fuck Forever'“) stecken die Alter Egos verschiedener Bandmitglieder – Bilo kennen wir aus Petes Libertines-Zeiten, und Stookie ist ein fiktiver schottischer Suffkopf, der von hartem Schnaps herbeigerufen wird. „Peter und Mik haben zwei schottische Alter Egos“, sagt Drew, „Jim und Stookie, die nach einer halben Flasche Jim Beam ihr hässliches Haupt erheben. Stookie ist Mik.“ Tatsächlich taucht auf dem Album ein ganzer Haufen von Petes Gefolge auf – Wolfman hat an „Unbilotitled“ mitgeschrieben, und zum letzten Song, „The Lost Art Of Murder“, hat der legendäre Folkgitarrist Bert Jansch Licks beigesteuert (Pete: „Ich hab damals in St. John’s Wood gewohnt, er in Kilburn. Er ist oft am Sonntagnachmittag vorbeigekommen, oder ich hab bei ihm vorbeigeschaut, und Alan [Wass] von Lefthand war auch oft da – jeder hat jeden besucht, und ab und zu saßen wir alle zusammen.“). Ein weiterer berühmter Name ist dabei, aber Pete mag nicht verraten, wo genau: „Albert Hammond Jr. hat bei einem Song ein bisschen Gitarre gespielt. Ich sage nicht, bei welchem, aber er ist dabei. Drei Takte lang.“ Die größte Aufmerksamkeit unter den Co-Credits wird jedoch sicherlich „You Talk“ gelten, dem Song, der uns am ehesten einen Einblick ins Bettgeflüster von Großbritanniens ehemals meistschikaniertem Promipaar gibt. „Das habe ich mit Kate geschrieben“, sagt Pete, „im Bett. Ich wollte ihr mit einem Song imponieren, sie hat dann einiges am Text geändert, und so hat es seinen Weg aufs Album gefunden.“
Aber die vielleicht rührendsten Andeutungen auf die stürmischen, traumatischen und zweifellos auch liebevollen paar Jahre, die Bilo genossen/ertragen hat, gibt es in „Baddies Boogie“, das scheinbar die Geschichte einer Beziehung erzählt.die nach 20 Jahren in die Binsen geht, im Kern jedoch davon handelt, wie eine glühende Liebe an der Rauschgiftsucht des Mannes zugrunde geht. Wer könnte dieser „Baddie“ sein, fragen wir uns. Petes Blick wird ernst. „Baddie ist ein stolzer Kerl, der weiß, dass er ein Bösewicht ist, und auf vielerlei Weise ist er zerstörerisch. Ein Schurke, der ein guter Mensch wird.“ Er grinst, ein Augenblick der Selbsterkenntnis. „Sie sind wie das A-Team, nichtsnutzige Typen, die überhaupt nicht zusammenpassen, aber sie werden irgendwie mit allem fertig.“
Wir sind Zurück im „Boogaloo“, beim letzten Chorus von „Pipedown“, und jetzt streift Pete alle Professionalität ab, wirft sich ins Publikum, besprüht jeden in Reichweite mit seinem Bier. Die Menge packt ihn, verschlingt ihn, und dann hebt sie ihn in die Höhe, wie einen Bösewicht, der ein guter Mensch wird, einen Nichtsnutz, der mit allem fertig wird.
Während der Song zusammenbricht und ausklingt, hechtet Pete zur Treppe hinter der Bar, raus auf die Straße, wo das Gewitter der Paparazzi-Blitzlichter die Fenster in riesige Stroboskope verwandelt. An der Bar erwacht Shane MacGown, beglotzt seine leere Weinflasche und schaut plötzlich sehr verwirrt drein. Als hätte er in genau dieser Sekunde begriffen: Hey, die Sache hätte anders laufen können, es könnte einen anderen Weg geben, dieses Leben zu leben, das man Rock’n’Roll nennt. Vielleicht, nur vielleicht, kann man sich die Punkrock-Freiheit in der Seele bewahren, ohne mit Suff und Drogen das Glänzen in den Augen zu löschen.
Vielleicht, ja, vielleicht – kann aus einem Junkie wieder ein Libertin(e) werden.
www.frenchdogblues.co.uk