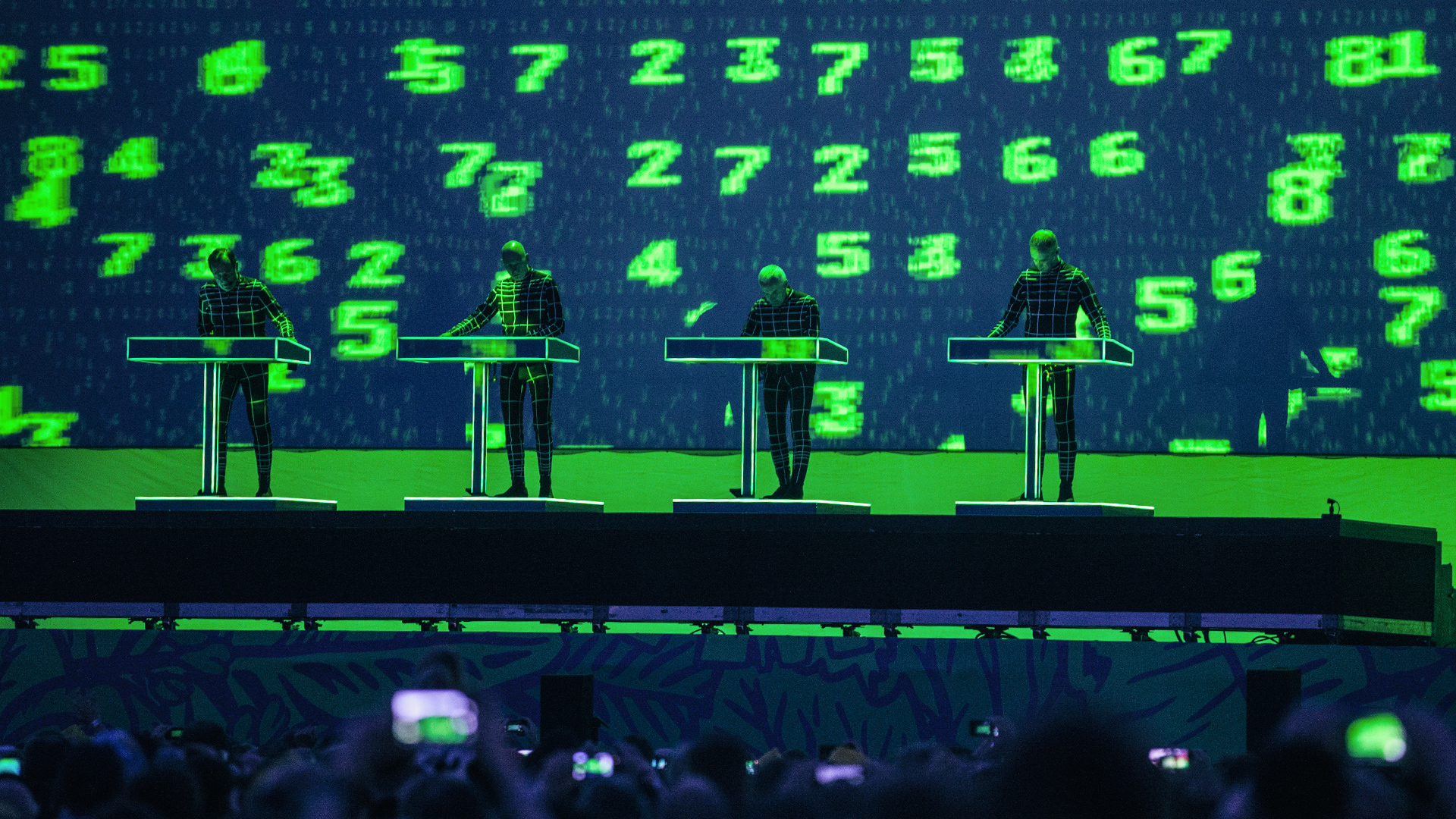Die 50 besten Platten des Jahres 2019
Wir haben abgestimmt und die (subjektiv) einzig wahre Liste erstellt: Das sind die 50 Favoriten der ME-Redaktion und somit die besten Alben des Jahres 2019. Ha!

10. Big Thief – U.F.O.F.
4AD/Beggars/Indigo (VÖ: 3.5.)
Ist das Elliott Smiths kleine Schwester? Als Big Thief im Mai ihr erstes von zwei atemberaubenden Alben 2019 in die Welt entließen, war die Folkrockband aus Brooklyn keine Unbekannte mehr. Auf Conor Obersts Qualitätslabel brachte sie bereits zwei in Insiderkreisen hochgeschätzte Platten heraus. Ein Geheimtipp blieb das Quartett um die auch solo veröffentlichende, in einem religiösen Kult geborene und heute 28-jährige Adrianne Lenker mit ihrem 4AD- Debüt dennoch. Vielleicht war U.F.O.F. zu leise, intim und schüchtern? Wer genauer hinhörte, fand sich nicht bloß wahlweise im Schlafzimmer der Band oder auf ihren Gitarrensaiten wieder, sondern entdeckte Kleinode wie „Orange“ und „Century“. Es ging um Leben, Sterben, Hunde und Motten. Wenn es U.F.O.F. an irgendetwas fehlte, dann nicht an Krach. Sondern an dem einen Indie-Hit. Aber den hatten sie für das nur Tage später aufgenommene TWO HANDS ja noch in der Hinterhand. Fabian Soethof
9. Tyler, The Creator – IGOR
Columbia/Sony (VÖ: 17.5.)
Vielleicht können wir das Jahr- zehnt mit dem Wissen beenden: The kids are all right. Zumindest hätte man sich nicht träumen las- sen, dass Tyler, The Enfant Terrible sich von der kaputten, nihilistischen Rap-Persona seiner ersten Alben in einen Meister der verspulten R’n’B-Heartbreak-Nummer verwandelt. Auf IGOR taucht er tief in sich kunstvoll zwischen Jazz, HipHop, Soul-Grooves und elektronischer Musik windende Arrangements ein. Und singt ohne Ironie Zeilen über die Liebe zu einem Garçon. Oder einfach: „I finally found peace, so peace!“ Überhaupt: Er singt sehr viel. Mit softer Stimme, oft durch wundersame Filter gejagt und einmal sogar Harmonien zusammen mit Solange. IGOR ist eine warme, dunstige Umarmung. Und Tylers Manifest als HipHop- Soul-Produzent auf den Spuren von Pharrell. Annett Scheffel
8. Stella Donnelly – BEWARE OF THE DOGS
Secretly Canadian/Cargo (VÖ: 8.3.)
„Die freundliche Feministin“ betitelten wir unser Porträt über die walisisch-australische Singer/Songwriterin im April. Denn Stella Donnelly ist wirklich außerordentlich charmant, fröhlich, witzig. Und sie ist Überbringerin feministischer und humanistischer Botschaften… Nein, kein „trotzdem“. Stella nutzt ihre positive Strahlkraft wie auch ihre enorme Stimme, ihr Songwriter-Talent zum Pop- wie zum Liedermacher-Kleinod und eine schier endlose Empathie, die durch ihre wachen, bissigen, aber eben auch sensiblen, sanft-lyrischen Texte spricht, um ihren Songs Nachdruck und eine Wärme zu verleihen, die erstaunlich lange anhält. Und das, obwohl sie neben zwei, drei Liebes- und Trennungsliedern von Missbrauch und Fremdbestimmung und australischen Schwachköpfen handeln. Oliver Götz
7. Sudan Archives – ATHENA
Stones Throw/RTD (VÖ: 1.11.)
Wenn Brittney Parks auf dem Cover ihres Debütalbums als Athene posiert, ist das kein Ausdruck von Hybris, sondern eine ziemlich genaue Selbsteinschätzung. Athene ist nicht nur die griechische Göttin der Kunst, sondern auch der Weisheit, der Strategie, des Kampfes und des Handwerks. All diese göttlichen Eigenschaften finden sich in der Musik und in den Texten von Sudan Archives wieder. Sie nimmt mit ihrer Geige sudanesische und ghanaische Musiktraditionen auf, wo das Instrument für den Rhythmus zuständig ist, nicht für die Melodie, verbindet sie mit der Soundästhetik des 10er-Jahre-R’n’B, mit elektronischen Backings, dezenten HipHop-Beats im minimalistischen Arrangement. ATHENA handelt auch von der Suche nach der Identität einer schwarzen Frau im sozial inkompetenten weißen Amerika. Albert Koch
6. Weyes Blood – TITANIC RISING
Sub Pop/Cargo (VÖ: 5.4.)
Schon als die Songs der klang- lichen Vorbilder von Natalie Mering alias Weyes Blood erstmals durchs Radio schallten, die geschmeidig-elegischen Klassiker von Carpenters, Judy Collins oder Carole King, dürften diese heftig nach „vor unserer Zeit“ geklungen haben. Eben nach melancholischer, sentimentaler Erinnerungs- und Vergänglichkeitsmusik, die jeder mit seinen eigenen und doch ähnlichen Bildern füllt. Doch so dramatisch und cineastisch (die über- große Abbildung des Lebens durch das Kino ist passenderweise ein Liedthema, neben der Suche nach Glaube, Liebe, Hoffnung) wie Weyes Blood ihre Einsame-Fackel- Songs hier inszeniert und mit ihrer wunderbar gnadenvollen Alt-Stimme noch überstrahlt, reißt uns solche Musik einfach mit wie im großen Strudel des titelgebenden Dampfers. Oliver Götz
5. Aldous Harding – DESIGNER
4AD/Beggars/Indigo (VÖ: 26.4.)
Was Aldous Harding anderen Künstler*innen voraushat, die sich im weiten/weiträumig abgeernteten Feld so ziemlich aller Musik- Genres abmühen: ihre Stimme. Sie ist derart ausdrucksvoll, besonders und wandlungsfähig, über- und widersteht Zeiten und Moden und kann selbst in Sounds und Weisen, die man auswendig zu keinen meint, den Unterschied machen. Was nicht heißt, dass die Neuseeländerin für ihr drittes Album nicht entscheidend an ihrem Song- writing gearbeitet hätte. Stücke wie „Fixture Picture“ oder „The Barrel“ sind verdammt elegante Folk(pop-) Ohrwürmer; (Klavier-)Balladen wie „Treasure“ und „Damn“ werden in einer Klarheit und Größe vorgetragen, die jede „Post-“Beschreibung abzuschütteln weiß. Die Platte mag konventioneller erscheinen als ihre Vorgänger. Aber wer sich in die vielen Details und rätselhaften Bilder, Metaphern und Parabeln in den Lyrics vergräbt, wird von der aktuellen Aldous Harding noch viel reicher beschenkt. Oliver Götz
4. Lana Del Rey – NORMAN FUCKING ROCKWELL
Polydor/Universal (VÖ: 30.8.)
Wo man in der Vergangenheit bei Lana Del Rey nie ganz sicher war, was Inhalt war und was Pose, hat sie nun Letztere beiseitegelegt. Textlich stärker denn je, ersetzt sie ihre oft fast an Werbeclips erinnernden Claims durch dunkle, nur auf den ersten Blick eindeutige California–Fantasien. Camp ist daran nichts, stattdessen findet Lana Del Rey in einer Reihe mit den Großen statt, mit Joni Mitchell, mit Chris Isaak, mit Cat Power. Es liegt an Produzent Jack Antonoff, dass diese Hollywood-Hills-Heavyness trotz ihrer Abgründe angemessen ausgeleuchtet ist. Er lässt mit seinen Arrangements Luft in die Songs, versieht sie mal mit Kammerpop-Fußnoten, mal mit Grüßen in den zeitgenössischen Pop-Mainstream. Nicht beteiligt war er bei einer interessant gewählten Coverversion: Lana Del Rey covert „Doin’ Time“, den Sublime-Track aus den frühen 90er-Jahren, der ja selbst eine Adaption von George Gershwins „Summertime“ ist, was ein Song ist, der auch irre gut zu Lana Del Rey passen würde. Ein Referenzspiel, das köstlichen Schwindel erzeugt. Jochen Overbeck
>>> weiter geht’s zu Platz 3 auf der nächsten Seite