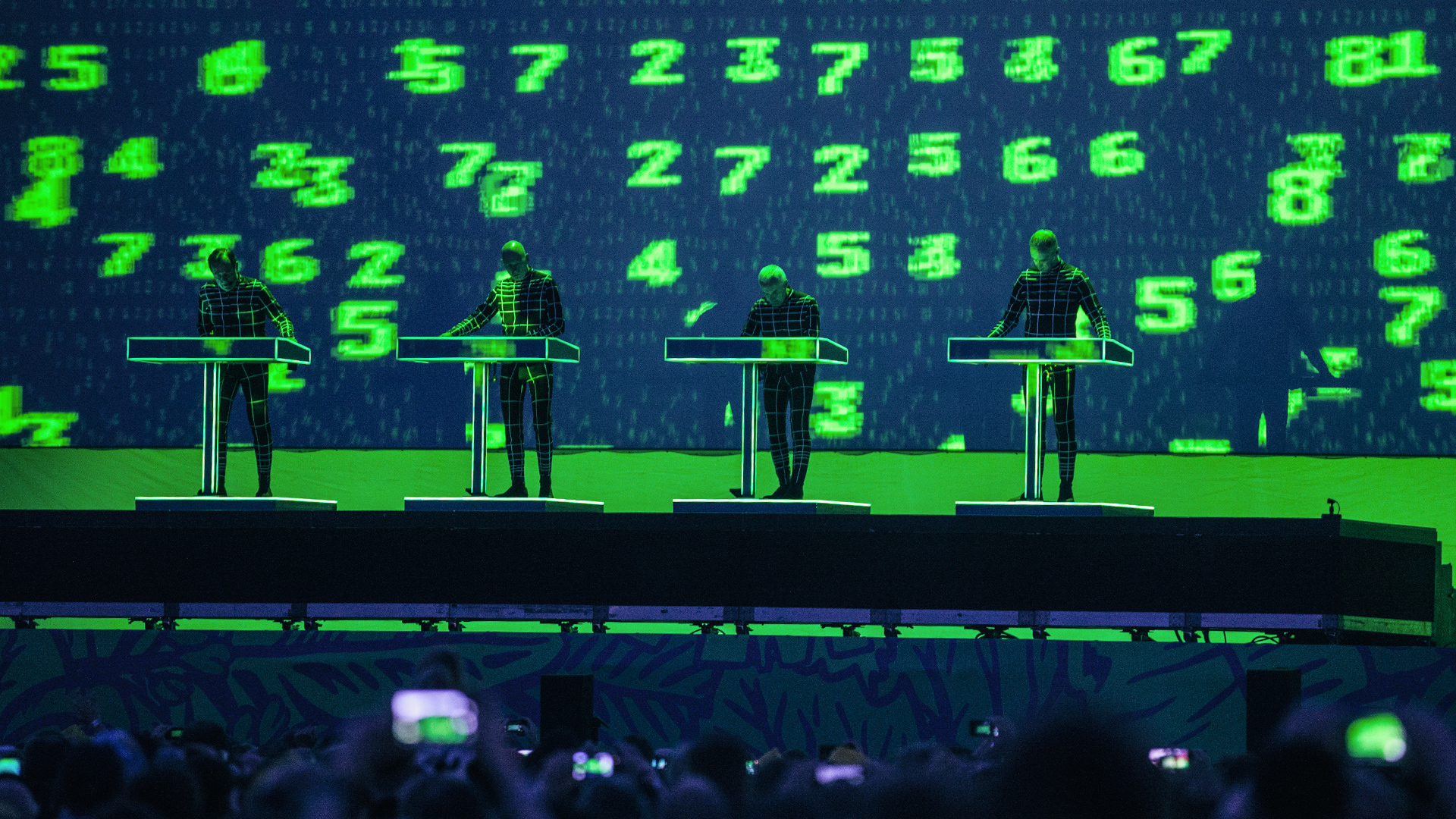„Es gibt eben nicht die eine Wahrheit!“
Zum 40-jährigen Jubiläum des MUSIKEXPRESS baten wir Sven Regener zum Gespräch, um von ihm das Phänomen Musikjournalismus beleuchten zu lassen. Hier das komplette Interview.

Der MUSIKEXRESS feierte (und feiert immer noch) dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Da sahen wir es an der Zeit, mal bei einem Musiker nachzufragen, wie sich das Treiben der Musikjournalisten für ihn eigentlich so anfühlt. Am besten bei einem, der selbst gut schreiben kann: Sven Regener, Element-Of-Crime-Vorstand und Roman-Autor.
Was war die erste Musikzeitschrift, die du gelesen hast?
Weil ich als Teenager kein so Pop- und Rockmusik-Typ war, sondern eher so ein Politfreak und zum Rock’n’Roll gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kinde, hab ich erst bei meiner ersten Band Zatopek angefangen Musikmagazine zu lesen, Sounds, Spex und auch die Stadtmagazine.
Gab es damals für dich Autoren, Musikjournalisten, an denen Du Dich besonders orientiert hast?
Für mich persönlich nicht. Aber was in Sounds Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre deutlich wurde, war, dass in deren Konzept langsam der Journalist auch der Star wurde. So einer wie Andreas Banaski alias Kid P war ja viel mehr Star als alles worüber er schrieb. Oder auf eine andere, so leicht Guru-hafte Art natürlich Diedrich Diederichsen. Und parallel wurden plötzlich auch die Produzenten wichtiger als die Musiker – alle wurden plötzlich wichtiger als die Musiker (lacht). Auch Plattenfirmenleute, etwa Tim Renner, der ja sowieso vom Musikjournalismus her kam…
Renner hatte in Hamburg ein Kassetten-Fanzine betrieben, bevor er in die Musikindustrie einstieg…
Ja, die Fanzines! In Hamburg oder Berlin war das Anfang der 80er wirklich toll, da kam jede Woche irgend so ein Blatt raus. Das ging über den normalen Musikjournalismus hinaus, jeder strickte da auf seine Weise mit an dem großen Ding was da „neue Musik“ hieß… eine Art Verlängerung des Punk mit anderen Mitteln. Aber natürlich war da auch eine tiefe Liebe zur Musik, die die Leute in diesen Fanzines antrieb.
Zu den größten Schwierigkeiten für Musikjournalisten gehört es, die Musik selbst mit den Mitteln der Sprache zu fassen. Wie fühlen sich für euch die Versuche von Kritikern an, Platten von Element Of Crime zu beschreiben?
Meistens ganz okay. Es ist ja ganz klar, dass das schwierig ist: Musik zu beschreiben ist wie ein Mittagessen zu erzählen – zumal man ja mit der Fachterminologie auch nicht weiter kommt, weil das der Leser nicht versteht. Deswegen kommen ja dann meist diese Vergleiche, die für einen Musiker immer kränkend, aber trotzdem unerlässlich sind. Dieses „klingt wie“ und „erinnert an“ widerstrebt im Grunde dem Narzissmus des Musikers, denn jeder will ja einzigartig sein.Gab es Kritiken, die für dich eine besondere Rolle gespielt haben?Ja. Eines der schönsten Beispiele, weil es meine gesamte Poetik damals in einem Bild zusammengefasst hat, das was ich künstlerisch erreichen wollte, war von Michael Zinsmaier vom Fanzine „Out Of Depression““ aus Konstanz. Der schrieb über unsere erste Platte „Basically Sad“ ungefähr so: „Eigentlich wollte ich immer schon nach New York und mich da in ein gelbes Taxi setzen und die ganze Nacht durch die Stadt fahren lassen, und durch das Fenster die Wolkenkratzer hochgucken – aber das brauch ich jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es nämlich Element Of Crime – und jetzt reicht auch mein Mofa, da nehm ich mir den Walkman mit und fahr durchs Neubauviertel – das hat den selben Effekt.“ Ein schöneres Kompliment haben wir nie bekommen.
Inwieweit registrierst du, dass sich im Musikjournalismus über die Jahre etwas verändert?
Mir fällt auf, dass viele der Journalisten mir nicht mehr begegnen, weil sie inzwischen etwas anderes machen. Musikjournalismus ist ja häufig eine Durchgangsstation, das macht man ein paar Jahre und geht dann in ein anderes Ressort. Andererseits gibt es dann auch Leute wie Detlef Kinsler, die ihr ganzes Leben dem Rock’n’Roll gewidmet haben und sich mit der Zeit fantastische Kenntnisse angeeignet haben, die uns Musiker ganz neidisch machen. Der Altersunterschied zwischen uns und den Interviewern wird auch immer größer – wir werden immer älter und die immer jünger (grinst).
Wie sehr befasst ihr euch mit den Kritiken, die ihr für ein neues Album oder die Konzerte während einer Tournee bekommt?
Man merkt schnell, wie viele Journalisten von anderen abschreiben. Wenn da einer mal den Begriff „Chefmelancholiker“ für dich aufbringt, dann taucht er danach 500mal in anderen Artikeln auf. Die richtigen Kritiken in den wichtigen Zeitungen und Magazinen lese ich alle. Allerdings muss man da stark sein! Nicht, weil die vielleicht negativ sind, sondern weil man eigentlich immer irgendwie widersprechen will – das ist der entscheidende Punkt: Nie wird ein Musikjournalist die Sache so sehen, die Platte so hören wie man selber!! Was man dabei aber lernt, ist: Auch kein anderer Hörer wird die Platte je so empfinden oder hören, wie man selber! Das ist das erste, was man begreifen muss, wenn man seine Erzeugnisse veröffentlicht und damit aus der Hand gibt: Jeder, aber auch wirklich jeder, empfindet sie völlig anders! Es gibt eben nicht die eine unumstößliche Wahrheit – und deswegen gilt: Niemals, wirklich niemals, sollte man sich über schlechte Kritiken beschweren! Kritiken sind eine Einbahnstraße und das ist auch richtig so. Wenn man das als Musiker nicht lernt, wird’s hart!
Interview: Christian Stolberg – 30.10.2009