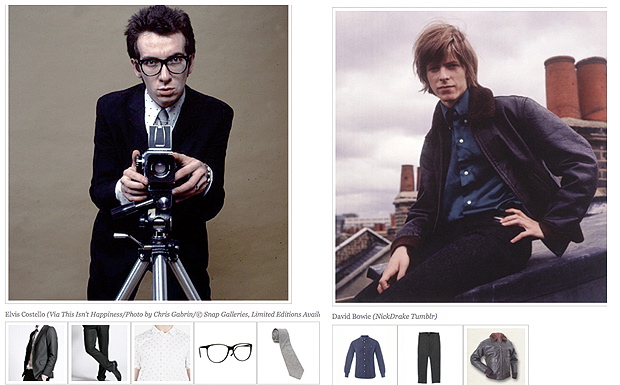Im Interview: Bryan Ferry über Konservatismus
Bryan Ferry ist ermattet. "Letzte Nacht ... die ganze Aufregung." Er schmunzelt und legt seine Füße hoch, sodass seine erbsenfarbenen Socken und der braune Cordanzug besser zur Geltung kommen. An seinem Kopfende wartet eine Flasche Champagner im Kühler.

Mr. Ferry, fühlen Sie sich wohl in der Gegenwart?
Natürlich, ich kann zum Beispiel Reisen unternehmen, die vor 30 Jahren unmöglich gewesen wären. Vorgestern war ich noch in Moskau, gestern in London, und heute sitze ich in Berlin.
Wir fragen, weil Sie sich ausgerechnet mit the jazz age zurückmelden – Ihre alten Hits in einem 20er-Sound. Fortschritt ist was anderes.
Das ist eine Erinnerung an meine Kindheit. In den 50er-Jahren begann ich im Radio Musik zu hören, und das war oft New-Orleans-Jazz. Über Skiffle und Blues bin ich dann bei Charlie Parker und Louis Armstrong gelandet. Es ist schon komisch: Beinahe 40 Jahre habe ich diese Musik nicht mehr gehört, inzwischen höre ich sie fast nur noch.
Böse Zungen könnten sagen: ganz schön konservativ.
Ich bin von Natur aus konservativ. Obwohl wir mit Roxy Music was Neues und – gestatten Sie mir das Wort – „Avantgardistisches“ machen wollten. Viele Künstler sind radikal in ihrer Arbeit und konservativ in ihrem Privatleben. Sie sehnen sich nach einer bürgerlichen Stabilität, nach einer Frau, Kindern, einem Hund. All das ist eine Art Bodenhaftung, von der aus man seine Leidenschaft als Künstler auslebt.
Der britische Philosoph Michael Joseph Oakeshott hat einst geschrieben: „Konservativ zu sein bedeutet, das Vertraute dem Unbekannten vorzuziehen, das Faktische dem Rätselhaften, das Eigentliche dem Möglichen.“
Ich mag Rätsel, macht mich das weniger konservativ? Ich fühle mich besser, wenn ich auf vertraute Dinge bauen kann. Allerdings probiere ich gern neue Sachen aus. Ich sehe mir moderne Kunst an, reise an mir unbekannte Orte. Anfang des Jahres war ich zum ersten Mal in Schanghai. Ich fühlte mich die ganze Zeit wie in einer Geschichte von James Ballard, die Stadt hat so einen retrofuturistischen Touch. Einerseits das Kolonialviertel der französischen Konzession, auf der anderen Flussseite die Metropolis von Pudong.
Ihre Ex-Premierministerin Margaret Thatcher hatte auch einen schönen Spruch: „Gute Konservative bezahlen immer ihre Rechnungen. Und zwar pünktlich.“
Schuldig, ich bezahle meine immer pünktlich. Da bin ich peinlich darauf bedacht. Ganz besonders, wenn es sich um Studiomusiker handelt. Ich werde verrückt, wenn mir mein Steuerberater sagt, er warte erst mal deren Rechnungen ab. „Nein, nein, bezahl sie sofort!“, sage ich. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie hart das Geschäft ist. Das hat etwas mit Respekt gegenüber den Menschen und ihrer Arbeit zu tun.
Der Begriff Konservatismus geht ja auf das lateinische Wort „etwas bewahren“ zurück …
… und das finde ich gut. Warum soll man gut funktionierende Dinge abschaffen? Zum Beispiel die roten Doppeldecker in London. Wie großartig war das, dass man einfach hinten aufspringen konnte. Dann kommt die EU oder irgendeine andere Behörde und behauptet, sie taugen nicht mehr für das moderne Leben. Mir ist eine gewisse Sensibilität gegenüber der Geschichte wichtig. Nennen Sie mich ruhig deshalb altmodisch.
Zurückgefragt: Was, glauben Sie, macht Sie altmodisch?
Dass ich musikalisch eine bestimmte Struktur bevorzuge. Nehmen wir elektronische Musik. Grundsätzlich finde ich sie gut. Nur fehlt es mir an Veränderungen darin. Es geht gut los, dumm-dumm-dumm, acht Takte weiter passiert nichts, 16 Takte, 32 Takte … vielleicht verändert sich jetzt das Hi-Hat-Gezischel. Gott, dafür habe ich nicht mehr die Geduld. Ich frage mich: Wo ist der Refrain?
Sind Sie im Zwischenmenschlichen altmodisch?
Ich halte bestimmte Formen im Umgang mit Menschen aufrecht und gute Manieren für wichtig.
Sie haben 2000 einmal Ihren Sohn getadelt, weil er geflucht hat, als das Flugzeug, in dem sie saßen, plötzlich absackte.
Würden Sie das nicht tun?
Nicht, wenn wie auf jenem Flug ein geistig verwirrter Passagier ins Cockpit eindringt und die Maschine beinahe abstürzt.
Ja, das war damals ein ganz besonderer Flug von London nach Nairobi. Das ganze Ereignis, wie der Kerl mit dem Kapitän kämpft, das Flugzeug absackt, das dauerte nur Sekunden. Es war der stärkste Sinkflug eines Linienflugzeuges, ohne dass es abgestürzt ist. Aber keine Sorge, so etwas passiert nicht oft.
In etwa so oft, wie Sie Ihren Stil wechseln … beinahe nie.
Sehen Sie, ich habe ein Lieblingsfoto aus meiner Studentenzeit in den 60er-Jahren in Newcastle. Da stehe ich vor meinem Auto, einem amerikanischen Studebaker, für den ich all mein Geld ausgegeben hatte. Ich habe einen dunkelblauen Mohair-Anzug an, beinahe identisch mit denen, die ich heutzutage auf einer Bühne trage. Ich wusste damals schon: Das ist mein Outfit.
Sie gehen lieber zu einem Savile-Row-Schneider als zu Dolce & Gabbana?
Oh, ich muss aufpassen, was ich sage. Ich kenne die Herren Dolce & Gabbana. Ihre Mode ist ziemlich cool. Ich habe jedoch ein Alter erreicht, in dem mir Anzüge aus der Savile Row besser stehen. Wissen Sie, jedes Mal, wenn auf einer Einladung „black tie“ steht, bin ich erleichtert. Ich brauche mir nichts ausdenken, muss nicht kreativ sein, ich ziehe einen Smoking an, basta. Das hat etwas, hm …
… Langweiliges?
Ich würde sagen: Professionelles. Ich weiß, das Einzige, worüber ich mir Gedanken machen muss, ist, welchen Wein ich dazu trinke.
Albumkritik S. 96
Bryan Ferry, geboren am 26. September 1945, wächst in einer Bauernfamilie auf, studiert Kunst und gründet 1970 mit Freunden (u. a. Brian Eno) die Band Roxy Music. Die hat später nicht nur enormen Einfluss auf New Wave, sie ist mit acht UK-Top-Ten-Alben vor allem sehr erfolgreich. Als Solokünstler (bisher 13 Alben) covert Ferry sehr gerne Songklassiker. Für das aktuelle Album seines Bryan Ferry Orchestras wurden nun zwölf seiner Hits im 20s-Jazzsound neu eingespielt.