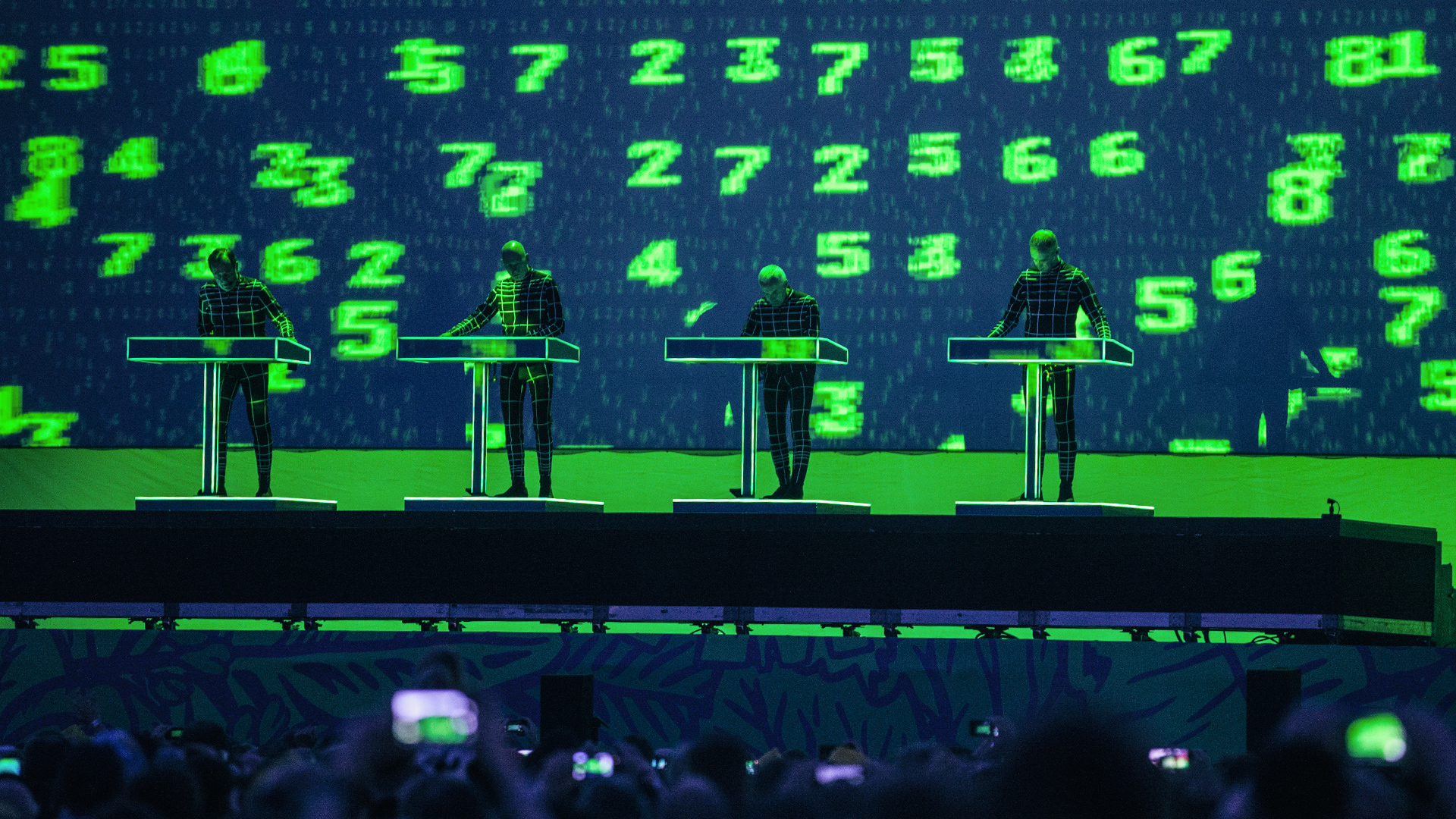Isle Of Wight Festival

Was die englische Tagespresse über Wight 1970 berichtete erweckte zweifellos den allgemeinen Eindruck, dass Chaos und Streitereien das Bild bestimmt haben und das verdienstliche Auftreten der Künstler und Gruppen nur eine Nebensache und also letztendlich unwichtig war. Schlagt nur mal die Zeitungen nach. Ihr werdet sehen, dass sich die Presseleute ihre Stifte abgewetzt haben über die hohen Gagen und grossen Verluste der Organisatoren, das Versagen der Leitung, die Nacktlauferei, den Gebrauch von Drugs und die vandalistischen Taten der Hell’s Angels, die dem letzten Tag des ach so fröhlichen Festivals mit ihren wüsten Schlägereien einen mehr als schalen Beigeschmack gaben. Ober die Musik wurde in den Zeitungen wenig berichtet, womit der eigentliche Sinn des Festivals an der Presse vorbeigegangen sein dürfte. Darum werden wir hier alle enorm guten Dinge, die wir selbst miterleben durften, noch einmal kurz beschreiben. Als wir Donnerstag Nacht nach einer ziemlich anstrengenden Reise auf der Insel ankamen, lief das Festival schon auf vollen Touren, aber man hatte irgendwie den Eindruck, dass alles ein bisschen unordentlich verlief. Nachdem wir nach einer Art Feldschlacht unsere Presseplätze erreicht hatten, konnten wir gerade noch miterleben, wie der Effekt der Black Widow im Nebel unterging, weil die Organisatoren den Auftritt der dazugehörigen nackten Mädchen verboten hatten. Nach den Black Widow spielten eine ganze Reihe unbekannter Gruppen, von denen sich Howl, eine Viermannformation aus Birmingham, durch besondere Qualität hervorhoben. Erst zu einem Zeitpunkt, da auf dem Festland bei den Leuten wahrscheinlich gerade die Wecker klingelten, war für diesen Donnerstag das Festival zuende. Die Festivalisten krochen tief in ihre Schlafsäcke, oder zogen auf dem Gelände herum in Erwartung dessen, was für den Freitag auf dem Programm stand.
Einer der ersten nennenswerten Auftritte dieses Tages waren die Arrival. Diejenigen, die die Gruppe schon einmal gesehen haben, waren allerdings etwas enttäuscht. Später sagte Frank Collins, ein Gitarrist der Gruppe uns, dass die Mädchen etwas nervös waren, weil ein grosses Festivalspublikum ja nun mal den Ruf hat, besonders kühl und kritisch zu sein. Glücklicherweise waren die Leute diesmal jedoch nicht zu streng. Absoluter Höhepunkt des Arrlval-Auftrittes war zweifellos ihre Gospel-Nummer „See The Lord“, bei deren Vortrag das Publikum mit Friedenssprüchen beschriebene Schilder hochhielt. Zum Dank bekamen die Arrival einen stürmischen Applaus, den sie so schnell nicht vergessen werden. „Und dann … ja, dann kamen die Taste. Von dem Augenblick an, da sie das Podium betraten, bis zu dem Moment, als sie es verliessen, begleitete sie aus der Zuschauermenge ein begeistertes Jauchzen, Stampfen und Klatschen. Man war hingerissen von jedem Solo, man verfolgte gebannt jede Bewegung des multitalentierten Sängers und Leadgitarristen Rory Gallagher. Obwohl Drummer John Wilson und Bassist Richie McCracken für eine ausgezeichnete Begleitung sorgten, war es Rory, der sicfi wie immer die Show Slam. Eine grosse Anzam von Fotografen, die sich in den komischsen Haltungen auf der Bühne drängten, um ein paar Fotos schiessen zu können, bewiesen mit der besonderen Aufmerksamkeit, die sie den Taste schenkten, einen grossartigen Instinkt für eine Formation, der zweifellos eine grosse Zukunft beschieden ist. Tausende von Fans belagerten die Bühne, ermutigten die Taste zu mehreren Zugaben. Noch dreimal steckten sie die Atmosphäre in Brand, das letzte Mal mit „Same Old Story“, dann verschwanden sie endgültig von der Bildfläche. Noch lange danach lag ein ohrenbetäubender Applaus in der Luft, man verlangte nach mehr Zugaben. Wenn Energie und Zeit es erlaubt hätten, hätten von uns aus die Taste von Morgens bis Abends spielen mögen, so gut war es. Und clean… so unheimucn ciean … Chicago bewiesen wieder einmal mehr, dass sie eine Gruppe von Weltklasse sind und Nummern, die wir alle schon von ihren Alben her kannten, wurden uns hier auf ganz neue, grandiose Weise serviert. Titel wie „Does Anybody Really Know What Time It Is“, „l’m A Man“ und „Mother“ machten den Auftritt, der demnächst auf einem Doppelalbum herausgebracht wird, zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Der Chicago-Sound war kaum verklungen, als schon Cactus die Bühne übernahmen. Diese relativ neue Formation, zu der auch zwei ehemalige Mitglieder der Vanilla Fudge gehören, imponierten mit einer sehr professionellen Show und waren des Zuhörens wohl wert. Nachdem sie nach einer Zugabe abgerauscht waren, ging es schon weiter mit Family, die die Leute sofort wieder zu neuen Begeisterungsstürmen veranlassten. Der Höhepunkt ihres Gigs war „The Weaver’s Answer“ und nach den Taste waren die Family die todsicheren Sieger des Tages. Nach Tony Joe White und den Lighthouse (Ihr seid ja bestimmt einverstanden, wenn wir uns einen Kommentar über diese Leute lieber schenken wollen) waren die Procol Harum dran, die man mit einem Wort nur als magnifique bezeichnen konnte. Sowohl die simplen Klänge von „Salty Dog“, als auch das überraschende Rock-Finale mit dem unsterblichen „Lucille“ liessen das doch eigentlich ganz schön verwöhnte Publikum in rasende Begeisterung ausbrechen. Das Programm am Samstag wurde von einem frischen, glattrasierten, bebrillten, blonden John Sebastian eingeleitet, einst die Seele der Lovin‘ Spoonful und heute ein erfolgreicher Solo-Interpret. Obwohl er jetzt eigentlich gar nicht mehr unbedingt wie ein Popsänger aussieht, sondern eher wie ein ehrgeiziger Student, brachte er es fertig, 90 Minuten lang die Leute zu totenstillem Zuhören zu bewegen. Er gefiel mit anspruchsvollen, sehr gefühlvollen Texten, alle von ihm selbst geschrieben. Seine erste Nummer war eine Ode an sein Mädchen, das irgendwo im Presseraum sass und ihm wiederholt zuwinkte. Von den Fans enthusiastisch aufgenommen wurden auch die alten Spoonful-Erfolge, die John aus der Mottenkiste gekramt und neu aufgemöbelt hatte. Hauptsächlich „Nashville Cats“ und „What A Oay For A Daydream“ kamen sehr gut an. Und als John plötzlich fragte, ob sein ehemaliger Mitmusiker Zal Yankowsky vielleicht auch zufällig anwesend sei – und dies schien tatsächlich der Fall zu sein brach das Jugendsentiment wieder los und man hatte beinahe das Gefühl, in die alten Tage der Spoonful zurückversetzt zu sein. Noch lange nach diesem Auftritt war jedem klar, dass er hier soeben wirkliche Rasse-Künstler erlebt hatte und dass deren Gage, so hoch sie auch immer gewesen war ehrlich verdient war. Wahrscheinlich hatte man die Erwartungen zu hoch geschraubt, vielleicht war auch die Erinnerung an die Nice noch zu ausgeprägt, wir wissen es nicht genau. Jedenfalls konnten Emerson, Lake and Palmer nicht halten, was ihr Name versprach. Dabei waren sie musikalisch nicht schlecht im Gegenteil. Die gewaltige Eröffnungsnummer „Barbarian“, bei der Keith Emerson gleichzeitig zwei Hammondorgeln bearbeitete, wurde vom Publikum sehr gut gewertet. Aber nach dieser enorm guten Nummer erschienen die nun folgenden Titel eher etwas ärmlich, daran konnte selbst die gute akustische Gitarre nichts mehr ändern. Ihr 40 Minuten langes „Pictures At An Exhibition“ war brilliant und die von Emerson abgeschossenen Kanonenkugeln waren umheimlich effektiv. Hinterher konnte man feststellen, dass dies ihre beste Nummer gewesen war. Ihre darauffolgende Version von „Rondo“ war längst nicht so gut, wie sie von den Nice gespielt worden wären. Die letzte Nummer „Nut Rocker“ war glattweg eine Enttäuschung. Für den nächsten Aufritt können wir der Gruppe eine Veränderung innerhalb des Repertoires anraten, eine bessere Zusammenstellung der Titel. Glücklicherweise waren die Ten Years After in ihrem Element. Sie spielten tatsächlich, als ginge es um ihr Leben, noch nie haben wir diese Formation derartig umwerfend gut erlebt. Obwohl die Klänge durch das miese Wetter hie und da etwas verformt wurden, hatte das keinen Einfluss auf den Enthusiasmus, mit dem die Gruppe ans Spiel ging. Angespornt von einem Publikum, das zwar erhitzt, aber „perfectly happy“ war, präsentierten sie uns „Love Llke A Man“ besser denn je zuvor. Ein Franzose liess sich dabei so sehr rühren, dass es ihn dazu bewegte, sich splitternackt auszuziehen und die Bühne zu erklimmen. Chic Churchills Orgel kam leider nicht gut durch, dafür durfte er sich nachher in einem Solo nach Herzenslust austoben. Als sie sich mit „l’m Going Home“ verabschiedeten, stand die Zuhörermenge auf, unterstützte den Gesang des etwas heiseren Alvin Lee und klatschte im Takt mit. Dass man dabei ab und zu mal einen falschen Ton zu hören bekam, konnte niemanden stören.
Über die Doors gibt es eigentlich wenig zu sagen, well sie hauptsächlich nur Nummern von ihren schon drei Jahre alten LP’s vorgetragen haben. Joni Mitchell schien bei einigen Elementen im Publikum nicht erwünscht zu sein. Der Auftritt wurde ihr mehr oder weniger unmöglich gemacht von ein paar Leuten, die lieber ein Free-Concert gehabt hätten und schon mitten in ihrer Interpretation des Titels „He’ll Do It For Free“ ihr Missfallen laut bekündeten. Nachdem man sich etwas beruhigt hatte und eine beinahe weinende Joni das Publikum etwas besänftigt hatte, wurde sie nach ihren Titeln „Big Yellow Taxi“ und „Both Sides Now“ mit einem grandiosen Applaus belohnt. Es schien, als wolle die Mehrheit der Leute sich für die Minderheit, die den Auftritt stören wollte, entschuldigen. Aber Joni verlless die Bühne beinahe fluchtartig und es bleibt die Frage, ob sie nach diesem Theater noch Lust verspürt, jemals wieder in Europa aufzutreten.
Sonntag war der letzte, und wie einem später bewusst wurde, gleichzeitig der unruhigste Tag des Festivals. In aller Herrgottsfrühe erklang die Musik des amerikanischen Folksingers Kris Kristofferson, ein heiterer, fröhlicher Sound, so richtig zum Wachwerden. Ihm folgte ein netter Ralph McTell, an dessen Songs man besonders die wunderschönen Lyrics schätzte. Unmittelbar nach ihm bestieg eine Chicago-artige Truppe das Podium. Heaven, so nannten sie sich, spielten anfangs etwas liederlich, brachten dann aber ein recht gutes Repertoire, dem dennoch ohne Zweifel das gewisse Etwas fehlte, das Chicago eben so gross gemacht hat.
Während die Free endlich ihr Programm begannen, fingen die Fans ausserhalb des Festival-Geländes unter Leitung einiger hundert Hell’s Angels an, die Zäune umzuwerfen. Sie stürmten auf das Gelände, brachten die Massen in Aufruhr und forderten die bis dahin so ruhig gewesenen Festivalbesucher zu Schlägereien heraus. Damit verlor der eigentlich sehr gute Auftritt der Free natürlich enorm, die friedliche Atmosphäre war hin. Die Jungen spielten fast alle Nummern ihrer LP „Fire And Water“ und mit ihrer Zugabe „Crossroads“ bereiteten sie so ziemlich allen Leuten im allgemeinen und den Cream-Fans im besonderen eine grosse Freude. Es war inzwischen ungefähr 4 Uhr nachmittags, als durch die Lautsprecher bekannt gegeben wurde, dass jeder von ausserhalb des Geländes hereinkommen dürfe, denn inzwischen hatte man doch schon festgestellt, dass mit Verlust gearbeitet wurde und man wollte weiteren Beschädigungen und Schlägereien zuvorkommen. „Wir sind unser Geld los. Aber das ist hier etwas, was nie mit Geld zu bezahlen wäre“, wurde ausgerufen, „macht etwas daraus und geht mit einem friedlichen Gefühl nach Hause“. Endlich wurde Donovan angekündigt. Donovan, der mit seinem alten, vertrauten Stil, mit seiner wässrigen, gefühlvollen Stimme Songs wie „Catch The Wind“ und „Three-Brothers“ interpretierte, lockte selbst die hinterm Ofen hervor, die bisher nicht so richtig hatten warmwerden können. Seine ganz alten Lieder „Mellow Yellow“, „Hurdy Gurdy Man“ und „Atlantis“ schlugen ein wie eine Bombe und bewegten die Leute zum Mitsingen. Der Applaus, der seinem Auftritt folgte, war sicher wohlverdient.
Pentangle, die anschliessend dran waren, waren, was die Qualität betrifft, einmalig, hatten aber nach unserem Geschmack nicht so lange zu dauern brauchen. Nach einem selten guten Auftritt der Moody Blues, deren „Question“ zehnmal besser klang, als auf der Platte, hörten wir uns als letzte Gruppe die Jethro Tull an.
lan Anderson mit seiner Rumpelstlelzchen-Show bewies wieder einmal, dass Musik und Humor, miteinander verbunden dynamische, kreative Kunst ergeben können. Dass das Publikum gleicher Meinung war, konnte man aus der minutenlangen Ovation entnehmen.
Jimi Hendrix, Joan Baez, Richtie Heavens und Leonard Cohen haben wir leider nicht mehr gesehen. Die Hell’s Angels fingen wieder einmal an, verrückt zu spielen, worauf sich viele, unter anderem auch wir, aus Sicherheitsgründen zurückzogen. Schade nur, dass auch diesmal eine nur kleine Gruppe das Festival für die übrigen Leute versaut hat.