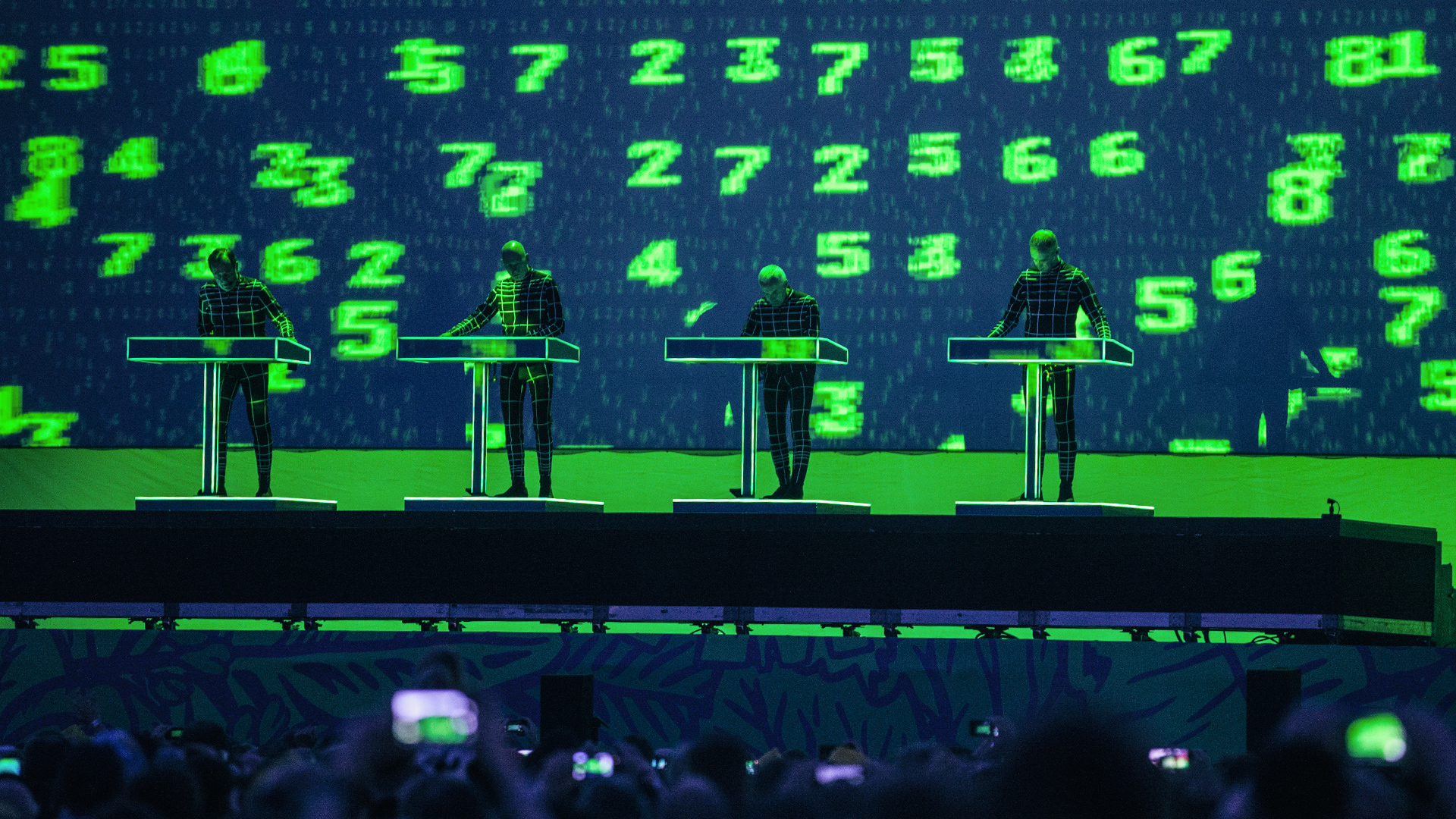Solche Gefühlsextremisten
Zu viel Gefühl? Nicht für The Magic Numbers. Und was haben sie davon? Menschen wollen in ihre Arme!

Das Konzert im Münchner Atomic Cafe endet mit einem langen Improvisationsinferno. Mit einem „Abgang wie bei Black Sabbath„, wie es die überglückliche Band nach der Show selbst auf den Punkt bringt. Ohrenbetäubend laut und weltvergessen hatten sich die drei auf der Bühne verbliebenen Mitglieder, Romeo Stodart (Gitarre, Gesang), seine Schwester Michelle (Bass, Gesang) und Sean Gannon (Schlagzeug), angestachelt durch ein euphorisiertes Publikum, in einen echten Rock’n’Roll-Rausch gespielt. So sehr, dass Keyboarderin Angela (Seans Schwester, auch Gesang und Percussion) nur noch abseits stehen und dem wilden Treiben lachend zuschauen konnte.
Falls dieser Beweis noch gefehlt hat: The Magic Numbers, die Folk-Pop-Band, die nach ihrem hochgelobten Debütalbum 2005 gerne als liebenswerte, sich in familiärer Harmonie sonnende Neo-Hippies dargestellt wurde, kann auch anders. Nämlich straight sein. So sollte es auch möglichst schnell gehen mit der zweiten Platte, trotz eines Jahres, das mit Touren u.a. mit den Flaming Lips, U2 und als Special Guest von Brian Wilson mehr als ausgefüllt war. Aber, so berichtet Romeo, „wir hatten all diese Songs undwussten, was für ein Album wir machen wollten. Es ist gut, nicht zu viel nachzudenken, sondern die Dinge einfach laufen zu lassen.“
those the brokes entstand in gerade einmal sechs Wochen, „aber wir sind Perfektionisten“, meint er, „wenn ich sechs Wochen sage, dann meine ich rund um die Uhr (lacht).“ Es gab ja auch einiges zu tun. Die Songs mussten nämlich zwei strenge Kriterien erfüllen. Erstens die Vermeidung allzu offensichtlicher musikalischer Zitate und Referenzen; zweitens die Emotionsgarantie („Erst, wenn wir selbst Gänsehaut kriegen, wissen wir: Das ist es!“). Herausgekommen ist ein Album, das man im Gegensatz zum unbekümmerten Debüt vielleicht nicht sofort in seine Arme schließt, das aufgrund seines größeren Detailreichtums und extremer Komplexität, seiner clever arrangierten Vokalharmonien und einer verstärkten Prise Soul nichtsdestotrotz einzig geliebt werden will.
Für diese Liebe geben The Magic Numbers alles, vor allem eben: ganz viel Gefühl. „Das istfiir uns nicht so schwierig“, sagt Romeo, „obwohl ich manchmal, wenn ich mit einem Song fertig bin, schon denke: ,Auweia!‘ Doch ich glaube nicht, dass es anders gehen könnte. Alle Songs, die wir selbst lieben, sind Songs, durch die man dem Text, dem Künstler und schließlich dem Song selbst vollkommenen Glauben schenkt.“
Es passt ins Bild vom Gefühlsextremisten,dass er unumwunden zugibt, geweint zu haben, als er das erste Mal „Hope There’s Someone“ von Antony &. The Johnsons hörte. Denn auch wenn die Magic Numbers auf der Bühne und im Gespräch die nettesten und unprätentiösesten Musiker sind, die man sich vorstellen kann – für ihre Musik gilt das höchstens eingeschränkt. Ihre oft melancholischen, manchmal fast depressiv zu nennenden Texte entstehen, „aus der Reflexion über das Leben, begangene Fehler, die Liebe und Verlust“, erzählt Romeo: „Eigentlich geht es einfach um alltägliche Dinge, Dinge, über die jeder nachdenkt. Doch das kann manchmal ziemlich düster werden.“
Vermutlich ist diese Kombination aus Liebenswürdigkeit und tiefer Emotionalitat, die jeder Mensch, der nicht nur an Oberflächen kratzt, sehr gut nachvollziehen kann, verantwortlich dafür, dass die Band von so vielen Menschen (vom Debüt gingen fast eine Million Exemplare über die Ladentische) extremistisch ins Herz geschlossen wird. Da gibt es Fans …: „Sie kommen auf mich zu und sagen: ,Ich muss dich einfach umarmen!‘ Das kann ganz schön peinlich werden. Sie kommen an und sagen: ,Oh, du bist wie ein kleiner Teddybär!‘ (lacht) Und ich finde das cool. Wirklich. Wenn die Leute die Musik so sehr lieben, dann ist das doch großartig.“